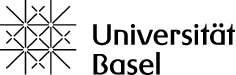Zurück zur Auswahl
12523-01 - Hauptvorlesung: Arzneiformenlehre I (feste, flüssige und disperse Arzneiformen) (5 KP)
| Semester | Herbstsemester 2011 |
| Angebotsmuster | Jahreskurs |
| Dozierende |
Jörg Huwyler (joerg.huwyler@unibas.ch, BeurteilerIn)
Georgios Imanidis (georgios.imanidis@unibas.ch) André Ziegler (andre.ziegler@unibas.ch) |
| Inhalt | Feste Arzneiformen: Arzneimittelentwicklung, Phasen, verwendete Arzneiformen, Zulassung, factorial Design mit Niveaus, Faktoren und Versuchsplan, Yates Schema für 2n Design, Central Composite Design und Scale-Up-Verfahren, Stabilisierungsmassnahmen, Stabilitätsprüfungen mit Arrhenius Gleichung, Wirkstoff-charakterisierung mit Bestimmungsmethoden, Ficksches Gesetz. Pulver: Korngrösse, Dichte (Aggregatzustand), Gestalt, Gewichtsanteilen, Definition mischen, Mischvorgang, Mischertypen, Entmischung, Prüfungen nach Arzneibuch Kapseln: Verwendung von Kapseln, Vorteile, Nachteile, Kapseltypen, Hilfsstoffe, Abfüllverfahren bei Hartgelatinekapseln, Verwendung von Weichgelatinekapseln, Herstellungsverfahren von Kapseln, Kapseln mit gezielter Freisetzung, Mikrokapseln, Koazervation, Prüfungen nach Arzneibuch Granulate: Granulierung, Granulatarten, Bindemittel, Aufgabe der Granulierflüssigkeit, Granulierverfahren, Feuchtgranulierung, Trockengranulierung, Abbauende Granulierung, Aufbauende Granulierung, Wirbelschichtgranulierung, Lochscheibengranulierung, Bindungsmechanismen in Granulate, Kinetik der Feuchtagglomeration, Stokessches Gesetz, Trocknen von Granulaten, Trocknungsverlauf, Trocknungskinetik, Sorption, Sorptionsisotherme, Restfeuchte, h,x-Diagramm, Trocknungsverfahren, Schütt- und Stampfvolumen, Fliesseigenschaften, Korngrössenverteilung, Prüfungen nach Arzneibuch Tabletten: Direktverpressung, Verpressung von Granulate, Mischzeiten, Tablettierhilfsstoffen, Exzenterpresse, Rundläuferpresse, Pressvorgang, In-Prozess-Kontrolle, Bindung und Kinetik von Tabletten, reversible und irreversible Verformung, Kraft-Zeit-Diagramm, Kraft-Weg Diagramm, Druckverteilung im Haufwerk, Druckübertragung der Stempel, Tablettierfehler (Deckeln, Kleben etc.), Tablettenformen, Manteltabletten, Buccal-/Sublingualtabletten, Brausetabletten, Prüfungen nach Arzneibuch. Flüssig-sterile Arzneiformen: (Zahl in Klammer gibt die Anzahl Lektionen wieder) Phasen der Entwicklung einer Arzneiform, Begriffe Pharmakokinetik und dynamik, Lösungen: Verteilungskoeffizient (Lipophilie, pKa-Wert), Eigenschaften (2); Raoultsches Gesetz, Clausius Clapeyron Gleichung für die Berechnung der ebullioskopischen bzw. Kryoskopischen Konstante, Zustandsdiagramm von Wasser (2); Löslichkeit: Einflussfaktoren auf die Löslichkeit, Raoultsches Gesetz und deren Abweichungen (positiv und negativ) auf Lösungsmittelgemische, Phasenübergang flüssig/gasförmig mittels Siede- und Kondensationskurven, Begriff Azeotrop, Aktivitätskoeffizient (1); Löslichkeit von nichtidealen Lösungen (1); Diagramme mit Mischungslücken, Bedeutung der kritischen Temperatur kennen, Dreiecksdiagramm und unterkühlte Schmelze (1); Polymorphie, Begriffe enantiotrop/monotrop, Bindungskräfte: Intermolekulare Bindungskräfte: Primär- und Sekundärbindungen, Welche Wechselwirkungen gehören zu den Van der Waals Wechselwirkunsenergien, Coulombsches Gesetz; Zusammenhang zwischen Ladung und Abstand, Dipolmoment berechnen (1); Dielektrizitätskonstante, Begriffe Polarisierbarkeit und Ionisationspotential, Wasserstoffbrückenbindung und Struktur von Wasser verstehen (1); Lösungsmittel: Perkolationstheorie auf pharmazeutische Prozesse anwenden, Eigenschaften von polaren und apolaren Lösungsmitteln, Begriff molare Polarisation, Clausius Mosotti/Debeye Gleichung (2); Faustregel Löslichkeitsparameter, Methoden zur Bestimmung der Löslichkeit, Zusammenhang Dielektrizitätskonstante und Löslichkeit, Experimentelle Bestimmung des Löslichkeitsparameters, Methoden der Löslichkeitsverbesserung, Kolloide: Definition und Einteilung von Kolloiden, Mizellen und CMC, Aufbau, Herstellung und Anwendung von Liposomen, Aufbau, Herstellung und Anwendung von Mikroemulsionen, Funktion von Netzmittel und Stabilitätserhöher, Eigenschaften von Gelatine (Sol-Gel Zustand) (2). Perorale Arzneiformen: Vor- und Nachteile von peroralen Arzneiformen, Anforderungen an die Dosierung flüssiger peroraler Arzneiformen, Wasserarten und Herstellung (1). Disperse Arzneiformen: (Zahl in Klammer gibt die Anzahl Lektionen wieder) Phasenregel, Grenzflächenspannung und Konsequenzen (Spreitbarkeit, Benetzung, Blasen, Tropfen) (2); Grenzflächenaktive Substanzen, Mizellbildung (2); disperse Systeme, Kolloide (1); Polymere, Viskositätserhöhung (1); Sedimentation, Flotation (1); Interpartikuläre Wechselwirkungen (van der Waals, elektrtische Doppelschicht, DLVO Theorie) (3); Rheologie (1); Emulsionen, Cremes (3); Feststoffsuspensionen, Pasten (2); Gele, Salben, Augensalben (2); Suppositorien, vaginale Formen (2); Aerosole, Schäume (1); Konservierung (1); Anwendung und Interaktion mit dem Epithel (2); Wirkstoff-Freisetzung und Absorption, Kinetik (3). |
| Lernziele | Vermittlung des Fachwissens und des Standes der Technik im Bereich der Verfahrenstechnik und als Fachspezialist für Medikamente (Industrie-, Offizin- und Spitalapotheker). Verständnis und Anwendung der Entwicklung und Herstellung eines Vehikels, d.h. einer Darreichungsform (Arzneistoffpräparat, Arzneiform), um einen (oder mehrere) Wirkstoff(e) sicher zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Quantität und Qualität an den Zielort im (am) Körper zu bringen, wo der Arzneistoff seine optimale Wirkung entfalten kann, um eine optimale Therapie mit minimalen Nebenwirkungen zu gewährleisten. Eine feste Arzneiform, eine Tablette oder gegebenenfalls eine Kapsel ist wenn immer möglich die Darreichungsform der Wahl. Keine andere Darreichungsform kann auf eine vergleichbare Erfolgsgeschichte zurückblicken. Rund 80% aller Arzneiformen auf dem Markt sind feste Arzneiformen. Vorteile der flüssigen Arzneiformen sind die mögliche individuelle Dosierung und schnelle Resorption. Dem gegenüber stehen die grösseren Gefahren von chemischen Instabilitäten und Inkompatibilitäten gelöster Wirk- und Hilfsstoffe. Die disperse Vorlesung befasst sich mit der Technologie der viskösen, mehrphasigen Arzneiformen. Sie vermittelt die grundlegenden Prinzipien auf welchen die Formulierung dieser Arzneiformen beruht und behandelt die Stoffe und die Herstellungsverfahren die dazu verwendet werden. Desweiteren werden die Eigenschaften und die Qualitätsmerkmale der Arzneiformen, und ihre Anwendung und Interaktion mit dem Epithel dargestellt und die Wirkstoff-Freisetzung und Absorption diskutiert. Der Teilnehmer bekommt das theoretische Wissen um solche Arzneiformen für einen gegebenen Wirkstoff entwickeln und gezielt nach technologischen Eigenschaften und Wirksamkeit optimieren zu können. |
| Literatur | Martin Physikalische Pharmazie, Hans Leuenberger (2001); Lehrbücher der Pharmazeutischen Technologie: Bauer, Frömming, Führer (2002); Sucker, Fuchs, Speiser (1991); Voigt, Fahr (2000). |
| Weblink | http://pharmtech.unibas.ch |
| Teilnahmevoraussetzungen | 1.-4. Semesters des Pharmaziestudiums |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Modul Pharmazeutische Technologie (Bachelor Pharmazeutischen Wissenschaften) (Pflicht) |
| Prüfung | Examen |
| Hinweise zur Prüfung | Mündliche Prüfung über Teile I & II nach dem Frühjahrssemester. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: in 'Belegungen'; Abm.: bei Studiendek. schriftlich |
| Wiederholungsprüfung | eine Wiederholung, bester Versuch zählt |
| Skala | 1-6 0,5 |
| Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Departement Pharmazeutische Wissenschaften |