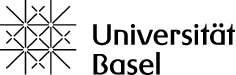Zurück zur Auswahl
36360-01 - Seminar: Lesekompetenz, Leseentwicklung und Leseleistung. Modelle, Förderkonzepte, Aufgaben und Leistungsmessung (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2014 |
| Angebotsmuster | einmalig |
| Dozierende |
Andrea Bertschi-Kaufmann (andrea.bertschi@unibas.ch, BeurteilerIn)
Tanja Graber (tanja.graber@unibas.ch) |
| Inhalt | Lesen - wie auch Schreiben - ist eine Schlüsselkompetenz und wesentliche Voraussetzung dafür, selbständig und erfolgreich am politischen, ökonomischen und sozio-kulturellen Leben einer Gesellschaft teilzuhaben. Was jedoch genau unter Lesekompetenz zu verstehen ist und wie diese sich in Theorie und Praxis modellieren sowie messen lässt, darüber gehen die Meinungen auseinander. Insbesondere nach den Leistungserhebungen im Rahmen von PISA, wonach in den deutschsprachigen Ländern die Leseleistungen der Schüler und Schülerinnen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, hat sich die Diskussion um Lesekompetenz noch intensiviert. Konzepte der Leseförderung und Beobachtungsinstrumente, die in der Schule verwendet werden und den Blick auf die Entwicklung des einzelnen Schülers bzw. der einzelnen Schülerin richten sollen, sind lesedidaktisch orientiert. Lesetests jedoch, welche für grosse Gruppen und zum Zweck des nationalen oder internationalen Leistungsvergleichs eingesetzt werden, berücksichtigen insbesondere testtheoretische Vorgaben und empirische Machbarkeit. Beiden Anwendungsbereichen - der schulischen Leseförderung und der breit angelegten Testung - liegen Modelle der Lesekompetenz zugrunde, die unter theoretischen wie praktischen Gesichtspunkten derzeit lebhaft diskutiert werden. Fokus der Diskussion sind die Aufgaben bzw. die Aufgabenformate, mit welchen Lesen gefördert und Leseleistungen überprüft werden. Im Seminar werden verschiedene Zugänge zur Modellierung von Lesekompetenz ebenso thematisiert wie einschlägige Aufgabenbeispiele. Möglichkeiten und Grenzen der Kompetenzerhebung werden im Kontext verschiedener Studien thematisiert. Dabei werden sowohl linguistische und psychologische als auch fachdidaktische Perspektiven berücksichtigt. |
| Lernziele | Die Studierenden sind mit den grundlegenden Prozessen des Leseverstehens vertraut. Sie kennen die unterschiedlichen Positionen zur Modellierung von Lesekompetenz sowie verschiedene Aufgabenformate und deren Einsatzmöglichkeiten und sie können diese im aktuellen Diskurs zur Lesekompetenz situieren. |
| Literatur | Bertschi-Kaufmann, Andrea (Hrsg.) (2007): Lesekompetenz, Leseleistung, Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien. Zug: Klett und Kallmeyer. Bertschi-Kaufmann, Andrea (2013): Jugendlektüre und Gratifikation. In: Rosebrock, Cornelia; Bertschi-Kaufmann, Andrea (Hrsg.): Literalität erfassen: bildungspolitisch, kulturell, individuell. Weinheim/Basel: Beltz/Juventa. Garbe, Christine/Holle, Karl/Jesch, Tatjana (2009): Texte lesen. Textverstehen. Lesedidaktik. Lesesozialisation. Paderborn: Schöningh. Groeben, Norbert/Hurrelmann, Bettina (Hrsg.) (2002): Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen. Weinheim: Juventa. Kintsch, Walter (1998): Comprehension. A Paradigm for Cognition. Cambridge: University Press. Lenhard, Wolfgang (2013): Leseverständnis und Lesekompetenz: Grundlagen - Diagnostik - Förderung. Stuttgart: Kohlhammer. Rosebrock, Cornelia/Nix, Daniel (20125): Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung. Hohengehren: Schneider. Spinner, Kaspar H. (2003): Lesekompetenz nach PISA und Literaturunterricht. In: Abraham, Ulf u.a. (Hrsg.): Deutschdidaktik und Deutschunterricht nach PISA. Freiburg: Fillibach, 238-248. Eine ausführliche Literaturliste sowie ausgewählte Texte werden vor Semesterbeginn zur Verfügung gestellt. |
| Bemerkungen | Teilnahmebeschränkung: 25 Personen. |
| Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Anmeldung über http://www.isis.unibas.ch erforderlich; und natürlich wegen der Kreditpunkte über Mona/Tell. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Modul Aufbaustudium Deutsche Sprachwissenschaft (Bachelor Studienfach: Deutsche Philologie) Modul Deutsche Sprachwissenschaft I (Master Studienfach: Deutsche Philologie (Studienbeginn vor 01.08.2013)) Modul Deutsche Sprachwissenschaft II (Master Studienfach: Deutsche Philologie (Studienbeginn vor 01.08.2013)) Modul Disziplinäre Vertiefung (Bachelor Studienfach: Deutsche Philologie) Modul Disziplinäre Vertiefung (Bachelor Studienfach: Deutsche Philologie (Studienbeginn vor 01.08.2013)) Modul Einführungswissen Deutsche Sprachwissenschaft (Bachelor Studienfach: Deutsche Philologie (Studienbeginn vor 01.08.2013)) Modul Fachwissenschaft / Deutsch (Master Educational Sciences (Joint Degree mit der PH FHNW)) Modul Forschungspraxis und Vertiefung (Master Studiengang: Sprache und Kommunikation) Modul Soziolinguistik (Master Studiengang: Sprache und Kommunikation (Studienbeginn vor 01.08.2013)) Modul Sprache und Gesellschaft (Master Studiengang: Sprache und Kommunikation) Weitere Lehrveranstaltungen für den Wahlbereich Deutsche Philologie (Master Studienfach: Deutsche Philologie) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Anwesenheit, aktive Mitarbeit, Präsentation mit Handout. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | Pass / Fail |
| Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft |