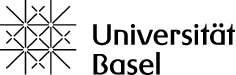Zurück zur Auswahl
39908-01 - Seminar: Identität und das Materiale. Vormoderne Dingwelten, Haushalte und gesellschaftliche Selbstentwürfe (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2015 |
| Angebotsmuster | einmalig |
| Dozierende | Lucas Burkart (lucas.burkart@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Der Anthropologe Igor Kopytoff hat 1986 einen wegweisenden Artikel mit dem Satz beginnen lassen: "For the economist, commodities simply are." Ob als solcher richtig oder nicht - der Hinweis war unmissverständlich: für Nicht-Ökonomen sind Güter erklärungsbedürftig. Auch die historischen Wissenschaften sollten für ihre Analysen der Welt der Dinge und Güter vermehrt Aufmerksamkeit beimessen. Die Anregung wurde verschiedentlich aufgegriffen etwa in der Konsumgeschichte, aber auch in anthropologisch und ethnologisch ausgerichteten Methodenangeboten, die in den Geschichtswissenschaften produktiv rezipiert wurden. Doch die historische Bedeutung von Materialität, so jüngere Ansätze, beschränkt sich nicht darauf, konsumiert und verzehrt zu werden - und sei es im symbolischen Verschwendungsakt. Die Welt der Dinge sei mit anderen Worten nicht nur Objekt subjektiver Weltdeutung und -gestaltung, also Repräsentation von Vorstellungen und Lebensweisen. Vielmehr prägt diese Welt ihrerseits Wahrnehmungen und Deutungen der Menschen durch ihre spezifischen Merkmale und Qualitäten. Materialität ist in verschiedener Hinsicht "geschichtsmächtig" - durch ihren Wert, ihre Mobilität, ihre Wahrnehmung (sehr wohl auch in körperlich-sensualer Weise) ihre Verwendung und Symbolik sowie schliesslich durch die Stiftung von Sozialbeziehungen. In diesem Sinn richtet das Seminar sein Augenmerk auf jüngere Ansätze, die nach der Bedeutung des "Materiellen" für vor-moderne Gesellschaften fragen. Hierfür sollen unterschiedliche soziale Sphären - Wissenschaft, Konsum, Güterzirkulation, Kult, Haus und Familie u.a.m. - in den Blick genommen und auf ihre spezifischen Materialitäten hin befragt werden. |
| Literatur | Bert de Munck, Artisans, Products and Gifts. Rethinking the History of Material Culture in Early Modern Europe, in: Past and Present 224, 2014, S. 39-74. |
| Bemerkungen | Fortgeschrittene Bachelor- und Masterstudierende der Geschichte. |
| Teilnahmevoraussetzungen | Abgeschlossene Grundstufe BA Geschichte (3 Proseminare und -arbeiten). |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot fakultativ |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Aufbaumodul Mittelalter (Bachelor Studienfach: Geschichte (Studienbeginn vor 01.08.2013)) Modul Aufbau Mittelalter (Bachelor Studienfach: Geschichte) Modul Epochen der europäischen Geschichte: Mittelalter (Master Studiengang: Europäische Geschichte) Modul Ereignisse, Prozesse, Zusammenhänge (Master Studienfach: Geschichte (Studienbeginn vor 01.08.2013)) Modul Kommunikation und Vermittlung historischer Erkenntnisse (Master Studienfach: Geschichte (Studienbeginn vor 01.08.2013)) Modul Methoden - Reflexion - Theorien: Differenz - Identität - Kritik (Master Studiengang: Europäische Geschichte) Modul Methoden und Diskurse historischer Forschung (Master Studienfach: Geschichte (Studienbeginn vor 01.08.2013)) Modul Mittelalter (Master Studienfach: Geschichte (Studienbeginn vor 01.08.2013)) Modul Mittelalter / Frühe Neuzeit (Master Studienfach: Geschichte) Modul Profil: Renaissance (Master Studiengang: Europäische Geschichte) Modul Profil: Vormoderne (Master Studiengang: Europäische Geschichte) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Aktive Teilnahme. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | Pass / Fail |
| Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Departement Geschichte |