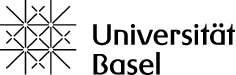Zurück zur Auswahl
25635-01 - Vorlesung mit Übungen: Environmental Systems: Transformation of Energy Systems to renewable Energy Flows 2010-2050 (2 KP)
| Semester | Herbstsemester 2015 |
| Angebotsmuster | unregelmässig |
| Dozierende | Rudolf Rechsteiner (rudolf.rechsteiner@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Wir untersuchen die Bestimmungsfaktoren für den Energiemix 2010-2050: • Entwicklung und Potentiale erneuerbare Energien und ihre Nutzungskosten • Ressourcen, Erschöpfungsraten, Nebenwirkungen nichterneuerbare Energien • Technische Entwicklung , Lernkurven und Bedarf an technischen und institutionellen Innovationen • Politisches Instrumentarium für eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien Der Blockkurs erstreckt sich über acht Halbtage und beinhaltet neben einer Vorlesung von jeweils 1,5 Stunden viel interaktives Lernen und Diskussion (inkl. Gruppenarbeiten, Kommunikationstraining, vorbereitete Podiumsdiskussionen) 1. Nach Fukushima: Der Streit um eine nachhaltige Energiepolitik Der Überblick: Technische und ökonomische Megatrends von erneuerbaren und nichterneuerbaren Energien: Energiepolitik der Schweiz: Neuausrichtung, ökologische und ökonomische Implikationen Gruppenübung: Entwicklung eines energiepolitischen Programms in Einzelgruppen, Präsentation und Diskussion 2. Wie verändern Einspeisevergütungen den europäischen Strommarkt? Entwicklung der erneuerbaren Energien in Europa und Auswirkungen auf die Preise, auf das Investitionsverhalten Kennenlernen der wichtigsten Förderinstrumente: Einspeisevergütungen, Prämien, Quoten, Auktionen und ihre Wirkung auf die Strukturierung der Stromgewinnung. Gruppenübung: Akteure entwickeln nachhaltige Strategie in Einzelgruppen: Hausbesitzende, Firma, Stadt, Elektrizitätswerk, Präsentation und Diskussion 3. Energiepolitische Instrumente: welche Massnahmen führen zum Ziel? Kennenlernen der Energiestrategie 2050 Ordnungsrechtliche und marktwirtschaftliche Instrumente im Umweltschutz: Erfolgsfaktoren und Defizite; Externe Kosten und Internalisierungskonzepte: Erfolgsbilanz nach 4 Jahrzehnten Umweltpolitik; Energiestrategie 2050: Vorschläge und Kritik Gruppenarbeit: „Arena“: Deckel weg bei den Einspeisevergütungen, Diskussion 4. Versorgungssicherheit im europäischen Kontext, Welches Portfolio an Techniken und Standorten eignet sich für eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien? Ausgleichsstrategien für fluktuierende Energien – Versorgungssicherheit in allen Jahreszeiten; Kostensenkungen dank erneuerbaren Energien: Rahmenbedingungen und Trends im EU-Strombinnenmarkt – Chancen und Risiken für die Schweiz Speichertechniken und ihre Limiten Gruppenarbeit: Strategie Vollversorgung – welche Standortvorteile hat die Schweiz? Präsentation/Diskussion 5. A) Nachhaltigkeit als wegleitendes Konzept – wann sind Energien nachhaltig? – B) Fossile Energien Teil A: Nachhaltigkeit als wegleitendes Konzept – wann sind Energien nachhaltig? Und wann ist Nachhaltigkeit in der Umweltpolitik erreicht? Konzepte, Indikatoren, Praxis Teil B. Fossile Ressourcen: Erschöpfungsraten und Umweltfolgen Kostenentwicklung und Preise Geopolitischer Einfluss von Erdgas (inkl. Schiefergas), Erdöl, Kohle und Uran Risiken, externe und interne Kosten der Kernenergie Prognosen: Kann man ihnen trauen? Gruppenübung: Arena: pro und contra CO2-Abgabe auf Treibstoffen, Diskussion 6. Effizienz: Ressource ohne Nebenwirkungen?/ neue Entwicklungen in der Photovoltaik Effizienz: Potentiale – Markthindernisse – Strategien Rebound-Effekte oder: weshalb die Effekte kleiner sind als gedacht Innovationen in der Photovoltaik Gruppenübung: Effizienzprogramme für die Schweiz – Instrumente – Träger - Dynamisierung Präsentation/Diskussion 7. Bedeutung der Windenergie im europäischen Kontext Charakteristiken der Windenergie im Vergleich mit anderen erneuerbaren Energien Investitions- und Beschaffungsstrategien verschiedener Akteure Rolle der Speicher und der Netze inkl. „smart Grids“: Markteintritt neuer Akteure und Finanzierungsstrategien Gruppenarbeit: neue Geschäftsmodelle: Investitionsstrategien für Elektrizitätswerke, Hausbesitzer und unabhängige Investoren 8. Problemkinder der Energiewirtschaft: Atomenergie und Agrotreibstoffe (Vor Vorlesungsbeginn: Kurze schriftliche Prüfung (30 Minuten) Entwicklung der Atomenergie seit 1945, Zukunftsaussichten, wirtschaftliche und technische Risiken in geöffneten Strommärkten Welche erneuerbaren Energien sind nachhaltig, welche nicht? Bodenbeanspruchung von verschiedenen Techniken Agrotreibstoffe und die Bodennutzungskonkurrenz mit Nahrungsmitteln Gruppenarbeit: Arena: brauchen wir neue Atomkraftwerke? Präsentation/Diskussion |
| Lernziele | - Sie kennen die konstitutiven Unterschiede von erneuerbaren und nichterneuerbaren Energien hinsichtlich Umweltprofil, Verfügbarkeiten, Finanzierung und Risiken - Sie kennen die Handlungsspielräume zur Deckung des Energiebedarfs von Industrie- und Schwellenländern sowie die technischen, wirtschaftlichen, geopolitischen Motive für eine Umstellung auf erneuerbare Energien - Sie kennen die Hindernisse auf dem Weg zur Vollversorgung mit erneuerbaren Energien und die marktwirtschaftlichen und ordnungsrechtlichen Instrumente zu deren Überwindung. |
| Literatur | http://www.rechsteiner-basel.ch/uploads/media/edoc_literaturliste_1210.xlsx |
| Weblink | www.umweltgeo.unibas.ch |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot fakultativ |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Modul Environmental Geosciences (Master Geowissenschaften) Modul Wahlbereich Energie und Klimawandel (Master Sustainable Development) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Aktive Teilnahme an der Veranstaltung sowie Kompetenznachweis (Prüfung am Freitag 18.12.15 als Teil des letzten Kursblocks) |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmelden: Belegen; Abmelden: Dozierende |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | Pass / Fail |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Geowissenschaften |