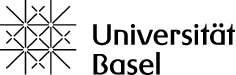Zurück zur Auswahl
45138-01 - Seminar: Kunst und Technologie (3 KP)
| Semester | Herbstsemester 2016 |
| Angebotsmuster | einmalig |
| Dozierende | Markus Klammer (markus.klammer@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Der enge Zusammenhang von Kunst und Technik hat eine lange Geschichte, die nicht nur im europäischen Kontext bis in die Anfänge künstlerischer Betätigung zurückreicht. Diese Verbindung ist bereits im griechischen Begriff der „techne“ angezeigt, der sowohl handwerklich und technisch Hervorgebrachtes als auch künstlerisch Geschaffenes meinen kann. Als Artefakt, als Produkt menschlicher Tätigkeit weist jedes Kunstwerk eine technische Seite auf. Diese wird gemeinhin auf die Materialität des Werks, auf das Wie seines Gemachtseins, auf die medialen Qualitäten seiner Darstellungsmittel bezogen. In diesem sehr allgemeinen Sinne ist „Technik“ Herstellungswissen. Der andere, ästhetische Aspekt des Werks wird in der Regel seine „Erscheinung“ genannt, verstanden als der durch das Werk vermittelte Eindruck, seine Fähigkeit, nicht nur eine geordnete Welt sinnlich vor Augen zu stellen, sondern zugleich politische, religiöse, soziale, epistemologische und andere Zusammenhänge zu symbolisieren. In der kantischen Philosophie des späten 18. Jahrhunderts wurde die Hauptaufgabe der Kunst in ihrem Vermögen gesehen, allgemeine Ordnungsprinzipien unseres Erkennens – Kant spricht von „Vernunftideen“ – sinnlich darzustellen. Diese Symbolisierungsleistung ist Kant zufolge eine Sache des „Genies“, sie kann nicht auf technischem Weg durch Regelanwendung erreicht werden. Sie lässt sich nicht lernen. Für das Werk des Genies gibt es keine Gebrauchsanweisung. Erst aufgrund des fertigen Werks können nach und nach dessen Konstruktionsprinzipien erkannt werden, die aber wiederum nur für die Beschreibung, nicht für die Herstellung großer Werke taugen, so Kant. Die Tendenz zum Ausblenden der technischen Seite der Kunst zugunsten ihrer ästhetischen und ideellen Momente erfährt im 19. und im 20. Jahrhundert eine massive Gegenbewegung. Mit der immer stärkeren Industrialisierung menschlicher Arbeit und dem Entstehen technologischer Formen der Bildgenerierung, -reproduktion und -verbreitung – wie Photographie und Film – wird das Kunstwerk in der Moderne zunehmend als ein Produkt verstanden, das nicht nur seine eigenen Konstruktionsbedingungen ausstellt, sondern den Stand der Technologie zu einem gewissen historischen Zeitpunkt und die damit verbundenen Phantasien, Utopien und Ideologeme reflektiert. Für Kunsthistoriker der Nachkriegszeit wie Sigfried Giedion oder Jack Burnham lag in den neuen technischen Möglichkeiten, wie sie von Kybernetik und Informationstechnologie verkörpert wurden, über den Bereich der Künste hinaus ein Heilsversprechen für die Gesellschaft als Ganzes. Nach einer allgemeinen Grundlegung des Zusammenhangs von Kunst und Technik wird sich das Seminar in erster Linie auf dessen Rekonfiguration in der Moderne konzentrieren, die unter technologischen Bedingungen steht und von der Auseinandersetzung mit automatisierten, naturwissenschaftlich gestützten Herstellungsverfahren in industriellem Maßstab geprägt ist. Im Fokus wird dabei einerseits die gemeinsame Arbeit und Diskussion von Grundlagentexten zur Thematik stehen und andererseits die Auseinandersetzung mit paradigmatischen künstlerischen Positionen des 19. und vor allem des 20. Jahrhunderts, wie Paul Cézanne, Matthew Barney, Fischli & Weiss, Jean-Luc Godard, Seth Price, Charles Ray, Allan Sekula oder Dziga Vertov. Gelesen werden Texte unter anderem von Theodor W. Adorno, Jack Burnham, Devin Fore, Alfred Gell, Martin Heidegger, Caroline Jones und Gilbert Simondon. |
| Teilnahmevoraussetzungen | Das Seminar richtet sich an Masterstudierende sowie an fortgeschrittene Bachelorstudierende. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot fakultativ |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Epochenmodul Moderne und Gegenwart (Bachelor Studienfach: Kunstgeschichte (Studienbeginn vor 01.08.2013)) Modul Aufbaustudium Grundlagentheorien der Medienwissenschaft (Bachelor Studienfach: Medienwissenschaft) Modul Forschungsorientiertes Studium (Master Studienfach: Medienwissenschaft) Modul Grundlagentheorien der Medienwissenschaft 3 (Master Studienfach: Medienwissenschaft (Studienbeginn vor 01.08.2013)) Modul Grundlagentheorien der Medienwissenschaft MA (Master Studienfach: Medienwissenschaft) Modul Grundlagentheorien der Medienwissenschaften 2 (Bachelor Studienfach: Medienwissenschaft (Studienbeginn vor 01.08.2012)) Modul Kunstgeschichte und Interdisziplinarität (Master Studienfach: Kunstgeschichte (Studienbeginn vor 01.08.2013)) Modul Kunsttheorie und Methodik (Master Studienfach: Kunstgeschichte) Modul Kunsttheorie und Methodik (Master Studiengang: Kunstgeschichte und Bildtheorie) Modul Kunsttheorie und Wissenschaftsgeschichte (Master Studienfach: Kunstgeschichte (Studienbeginn vor 01.08.2013)) Modul Moderne / Gegenwart (Bachelor Studienfach: Kunstgeschichte) Modul Profil: Moderne (Master Studiengang: Kunstgeschichte und Bildtheorie) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Mündliche Präsentation, Stundenprotokoll, aktive Mitarbeit |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | Pass / Fail |
| Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Kunstgeschichte |