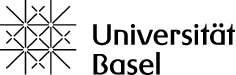Zurück zur Auswahl
50459-01 - Proseminar: Drama der Macht - Macht des Dramas: Inszenierung von Herrschaft auf der Bühne im 17. und 18. Jahrhundert (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2018 |
| Angebotsmuster | einmalig |
| Dozierende | Agnes Hoffmann (agnes.hoffmann@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Despotismus, Hofintrigen, Fürstenmorde: In den deutschsprachigen Dramen des 17. und 18. Jahrhunderts sind politische Herrschaft und staatliche Machtverhältnisse ein zentraler Bühnenstoff. Während zwischen Dreissigjährigem Krieg und Französischer Revolution in ganz Europa Regierungen wechseln und Staatsgefüge sich neu formieren, werden zeitgleich auch in Theaterstücken von Gryphius bis Schiller Herrschaftsformen verhandelt und machtpolitische Winkelzüge inszeniert. Gattungsbezogene Zielsetzungen wie z.B. die Darstellung historischer Stoffe im Geschichtsdrama und die Belehrung und Erbauung des Theaterpublikums, die in Dramenpoetiken der Zeit gefordert werden, verbinden sich dabei mit der dramatischen Exposition weitreichender Fragen – etwa nach dem Verhältnis von individuellem Machtstreben und Gemeinwohl und der theologischen oder staatsrechtlichen Legitimation politischer Souveränität. Das Proseminar untersucht die Darstellung von Macht und politischer Herrschaft im Theater am Beispiel einschlägiger Tragödientexte von – vorbehaltlich – Andreas Gryphius (Carolus Stuardus, 1657/63) und Daniel Casper von Lohenstein (Agrippina, 1665) über Johann Christoph Gottsched (Sterbender Cato, 1732) und Christian Felix Weiße (Richard III, 1759) bis zu Friedrich Schiller (Maria Stuart, 1800). Ein besonderes Interesse wird dabei auf der Inszenierung des Königs- bzw. Königinnenmords in den Stücken liegen: Repräsentiert die Figur des Souveräns auf der Bühne das (imaginäre) Zentrum der Staatsmacht, so lassen sich ihr physischer Tod mitsamt der Schicksalswendungen und Intrigen, die auf ihn hinführen, als dramatischer Kern des jeweiligen politischen Machtspiels verstehen. Neben der Verhandlung von Macht in den genannten Dramen wird das Proseminar zugleich auch nach der Macht des Dramas fragen, d.h. nach der intellektuellen und affektiven Wirkung von Geschichts- und Königsdramen auf das Theaterpublikum, wie sie seit dem 18. Jahrhundert verstärkt in Dramentheorien von Gottsched, Lessing, Schiller und anderen diskutiert wird. |
| Lernziele | Die Studierenden erarbeiten sich literaturwissenschaftlich relevante Zugänge zu exemplarischen Texten im historischen, kulturellen und sozialen Kontext ihrer Entstehung sowie im Kontext der Rezeptionsgeschichte und der aktuellen Forschung. Von hier aus sollen – auch über das Textkorpus des Seminars hinaus – erste literaturwissenschaftliche Arbeiten selbständig entstehen können. |
| Literatur | Zur Einführung: Peter-André Alt: „Der zerstückte Souverän. Zur Dekonstruktion der politischen Theorie im Drama des 18. Jahrhunderts (Gottsched, Weiße, Buri).“ In: Deutsche Vierteljahresschrift für Lit.wissenschaft und Geistesgeschichte 1:2001, S. 74–104. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Modul Einführungswissen Neuere Deutsche Literaturwissenschaft (Bachelor Studienfach: Deutsche Philologie (Studienbeginn vor 01.08.2013)) Modul Grundstudium Neuere deutsche Literaturwissenschaft (Bachelor Studienfach: Deutsche Philologie) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Regelmäßige Teilnahme, Übernahme von Impulsreferaten und/oder anderweitigen Arbeitsaufträgen, Mitwirken bei einer Arbeitsgruppe und/oder Erfüllen kleiner Schreibübungen im Hinblick auf die Proseminararbeit. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | Pass / Fail |
| Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft |