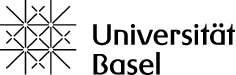Zurück zur Auswahl
60401-01 - Seminar: 'Gender' und 'Medizin' (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2021 |
| Angebotsmuster | unregelmässig |
| Dozierende | Frank Luck (frank.luck@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Zurzeit sind Fragen zur Gesundheit besonders virulent, weil sich im Rahmen gesellschaftlicher Transformationsprozesse diese als Wechsel in Perspektiven und als Veränderung bisheriger ‚sicher geglaubter Selbstverständlichkeiten‘ präsentieren können. In Bezug auf Gesundheit und Krankheit fehlen aber zufolge Wattenberg, Lätzsch, & Hornberg, „[…] immer noch vertiefende Erkenntnisse und differenzierte Daten zum Einfluss des Geschlechts auf Gesundheit, Krankheit, gesundheitsbezogene Einstellungen und Verhaltensweisen“ (Wattenberg, Lätzsch, & Hornberg, 2019, S. 1194). Nach wie vor ist es nicht selbstverständlich, Wechselwirkungen von ‚Gender‘ und ‚Medizin‘ in Forschung, Lehre, Therapie, Behandlung und Pflege zu berücksichtigen, vielmehr sind diese weiter zu befördern (vgl. Wattenberg et al., 2019). Mit diesem Seminar und seinem inter-und transdisziplinären Ansatz, soll dazu ‚ein weiterer Schritt‘ unternommen werden. Im Seminar wollen wir uns, Geschlechterverständnisse in ‚der Medizin‘ und medizinische Bezüge in ‚der Geschlechterforschung‘ anschauen. Welche wissenschaftlichen Perspektiven zu ‚Gender‘ und ‚Medizin‘ können aktuell beschrieben werden? Welche gesellschaftlich-historischen Entwicklungen sind für ein aktuelles Verständnis von ‚Gender‘ und ‚Medizin‘ bedeutsam? Welche Themen sind für die Gesundheitsversorgung relevant? Wo und wie wird das Wissen zu ‚Gender‘ und ‚Medizin‘ erforscht, gelehrt und in der Gesundheitsversorgung berücksichtigt? Anvisierte Fragen und Themen für das FS 2021 sind (Arbeitsversion, Stand 15. Oktober 2020): - „Welche Aspekte sind für eine gendersensible Gesundheitsversorgung von Bedeutung?“ - „Haben ,nur‘ Frauen* eine postpartale Depression?“ - Fitness – ‚Körper‘ – Geschlecht – Sport - Medizinische, rechtliche und gesellschaftliche Fragen im Kontext von Geschlechtervarianz (z. B. Trans*) - Was hat Männlichkeit mit Gesundheit zu tun? |
| Lernziele | - Die Student*innen verfügen über Wissen zum Themenfeld ‚Gender‘ und ‚Medizin‘ auf der Grundlage epidemiologischer Daten. - Den Student*innen wird das kritische und analytische Denken vermittelt, um geschlechterstereotype Sichtweisen im Themenfeld ‚Gender‘ und ‚Medizin‘ zu erkennen und diese kritisch zu reflektieren. - Die Student*innen sind fähig, Theorien und Konzepte aus der Geschlechterforschung mit ‚Gender‘ und ‚Medizin‘ zu kontextualisieren. - Die Student*innen können Aspekte für eine geschlechtssensible Gesundheitsversorgung benennen und diese auf eine Umsetzung hin in der Schweiz kritisch diskutieren. - Der Selbstbezug auf das eigene Wissen und Handeln ermöglicht, das im Seminar erarbeitete Wissen als eine Stärkung persönlicher Reflexionskompetenzen zu nutzen. |
| Literatur | Mögliche Literaturquellen (Stand: 13. April 2021): APA – American Psychological Association, Boys and Men Guidelines Group. (2018). APA guidelines for psychological practice with boys and men. Zugriff am 23. November 2020, auf https://www.apa.org/about/policy/boys-men-practice-guidelines.pdf Bourdieu, P. (2005). Die männliche Herrschaft. (J. Bolder, Übers.). Frankfurt am Main: Suhrkamp (Original publiziert 1998). Brunnett, R. (2009). Die Hegemonie symbolischer Gesundheit. Eine Studie zum Mehrwert von Gesundheit im Postfordismus. Bielefeld: transcript. Campo-Engelstein, L. (2012). Contraceptive Justice: Why we need a male pill. The Virtual Mentor: VM, 14(2), 146–151. https://doi.org/10.1001/virtualmentor.2012.14.2.msoc1-1202 Connell, R. (2015). Der gemachte Mann: Konstruktion und Krise von Männlichkeiten (4. durchgeseh. u. erw. Aufl.). Wiesbaden: Springer VS. de Visser, R. (2019). Gender and Health. In C. D. Llewellyn, S. Ayers, Ch. McManus, St. Newman, K. J. Petrie, T. A. Revenson & J. Weinman (Hrsg.), Cambridge Handbook of Psychology, Health and Medicine (3. Aufl.) (S. 20–24). Cambridge: Cambridge University Press. Dinges, M. (2016). Männergesundheit im Wandel: Ein Prozess nachholender Medikalisierung? Bundesgesundheitsblatt, 59(8), 925–931. https://doi.org/10.1007/s00103-016-2376-x Dinges, M. (2020). Die Bedeutung der Kategorie Gender für Gesundheitschancen (1980–2018), MedGG 38, S. 43–66. Dismore, L., Van Wersch, A., & Swainston, K. (2016). Social constructions of the male contraception pill: When are we going to break the vicious circle? Journal of Health Psychology, 21(5), 788–797. https://doi.org/10.1177/1359105314539528 Duden, B. (1991). Geschichte unter der Haut: ein Eisenacher Arzt und seine Patientinnen um 1730. Stuttgart: Klett-Cotta. Dumbaugh, M., Bapolisi, W., Bisimwa, G., Mwamini, M.-Ch., Mommers, P. & Merten, S. (2019). Navigating fertility, reproduction and modern contraception in the fragile context of South Kivu, Democratic Republic of Congo: ‘Les enfants sont une richesse’. Culture, Health & Sexuality, 21(3), 323–337. https://doi.org/10.1080/13691058.2018.1470255 Franconi, F., Brunelleschi, S., Steardo, L., & Cuomo, V. (2007). Gender differences in drug responses. Pharmacological research, 55(2), 81–95. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2006.11.001 Graf, J. (2013). Leistungsfähig, attraktiv, erfolgreich, jung und gesund: Der fitte Körper in post-fordistischen Verhältnissen. Body Politics, 1(1), 139–157. Gugutzer, R. (2015) Soziologie des Körpers (5. vollst. überarb. Aufl.). Bielefeld: transcript. Hammarström, A., Johansson, K., Annandale, E., Ahlgren, Ch., Aléx, L., Christianson, M., Elwér, S., Eriksson, C., Fjellman-Wiklund, A., Gilenstam, K., Gustafsson, P. E., Harryson, L., Lehti, A., Stenberg, G. & Verdon, P. (2014). Central gender theoretical concepts in health research: the state of the art. Journal of Epidemiology & Community Health, 68(2), 185–190. http://dx.doi.org/10.1136/jech-2013-202572 Hanses, A. (2010). Gesundheit und Biographie - eine Gradwanderung zwischen Selbstoptimierung und Selbstsorge als gesellschaftliche Kritik. In B. Paul & H. Schmidt-Semisch (Hrsg.), Risiko Gesundheit. Über Risiken und Nebenwirkungen der Gesundheitsgesellschaft (S. 89–103). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Hatzenbuehler, M. L., Nolen-Hoeksema, S., & Dovidio, J. (2009). How Does Stigma “Get Under the Skin”?: The Mediating Role of Emotion Regulation. Psychological Science, 20(10), 1282–1289. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2009.02441.x Hendricks, M. L., & Testa, R. J. (2012). A Conceptual Framework for Clinical Work with Transgender and Gender Nonconforming Clients: An Adaptation of the Minority Stress Model. Professional Psychology: Research and Practice, 43(5), 460–467. https://doi.org/10.1037/a0029597 Jacke, K. & Palm, K. (2021). Materialisierte Intersektionalität – biologische Verkörperungen sozialer Differenz. In A. Biele Mefebue, A. D. Bührmann & S. Grenz (Hrsg.), Handbuch Intersektionalitätsforschung. Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-26613-4_50-1 Kickbusch, I. & Hartung, S. (Hrsg.). (2014). Die Gesundheitsgesellschaft: Konzepte für eine gesundheitsförderliche Politik (2. vollst. überarb. Aufl.). Bern: Huber. Laquer, Th. (1992). Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Geschlechter von der Antike bis zu Freud. Frankfurt: Campus. Maihofer, A. (1995). Geschlecht als Existenzweise. Frankfurt am Main: Helmer. Luy, M. (2016). The impact of biological factors on sex differences in life expectancy: insights gained from a natural experiment. In M. Dinges & A. Weigl (Hrsg.), Gender-Specific Life Expectancy in Europe 1850–2010 (Medizin, Gesellschaft und Geschichte MedGG-Beiheft 58. Jahrbuch des Institutes für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung) (S. 17–46). Stuttgart: Steiner. vergleiche auch dazu aktuell: Deutsch-Österreichische Klosterstudie/German-Austrian Cloister Study (Österreichische Akademie der Wissenschaften/Austrian Academy of Sciences). (2020). Fachportal. Zugriff am 19. März 2021, auf http://www.cloisterstudy.eu/ Martschukat, J. (2019). Das Zeitalter der Fitness. Wie der Körper zum Zeichen für Erfolg und Leistung wurde. Frankfurt am Main: Fischer. Oyěwùmí, O. (1997) Colonizing Bodies and Minds. In O. Oyěwùmí (Hrsg.), The invention of women : making an African sense of Western gender discourses (121–156). Minneapolis: University of Minnesota Press. Penz, O. (2010). Schönheit als Praxis. Über klassen- und geschlechtsspezifische Körperlichkeit. Frankfurt am Main: Campus. Schnabel, P.-E. (2015). Einladung zur Theoriearbeit in den Gesundheitswissenschaften. Wege, Anschlussstellen, Kompatibilitäten. Weinheim: Beltz Juventa. Schroer, M. & Wilde, J. (2016). Gesunde Körper – kranke Körper. In M. Richter & K. Hurrelmann (Hrsg.), Soziologie von Gesundheit und Krankheit (S. 257–271). Wiesbaden: Springer. Schwamm, Ch. (2018). Irre Typen? Männlichkeit und Krankheitserfahrung von Psychiatriepatienten in der Bundesrepublik (1948–1993) (Medizin, Gesellschaft und Geschichte MedGG-Beiheft 68. Jahrbuch des Institutes für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung). Stuttgart: Steiner. Selke, St. (2016). Quantified Self statt Hahnenkampf. Die neue Taxonomie des Sozialen. Bundesgesundheitsblatt, 59(8), 963–969. https://doi.org/10.1007/s00103-016-2381-0 Shropshire, S. (2014). What's a Guy To Do?: Contraceptive Responsibility, Confronting Masculinity, and the History of Vasectomy in Canada. Canadian bulletin of medical history = Bulletin canadien d'histoire de la medecine, 31(2), 161–182. https://doi.org/10.3138/cbmh.31.2.161 Stiawa, M., Müller-Stierlin, A., Staiger, T., Kilian, R., Becker, T., Gündel, H., Beschoner, P., Grinschgl, A., Frasch, K., Schmauß, M., Panzirsch, M., Mayer, L., Sittenberger, E., & Krumm, S. (2020). Mental health professionals view about the impact of male gender for the treatment of men with depression - a qualitative study. BMC psychiatry, 20(1), 276. https://doi.org/10.1186/s12888-020-02686-x Terry, G., & Braun, V. (2012). Sticking My Finger up at Evolution: Unconventionality, Selfishness, and Choice in the Talk of Men Who have had “Preemptive” Vasectomies. Men and Masculinities, 15(3), 207–229. https://doi.org/10.1177/1097184X11430126 Wattenberg, I., Lätzsch, R. & Hornberg, C. (2019). Gesundheit, Krankheit und Geschlecht: ein gesundheitswissenschaftlicher Zugang zu Einflussfaktoren und Versorgungssystem. In B. Kortendiek, B. Riegraf & K. Sabisch (Hrsg.), Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung. Band 2 (S. 1193–1202). Wiesbaden: Springer VS. WHO – World Health Organization. Regional Office for Europe. (2018). The health and well-being of men in the WHO European Region: better health through a gender approach. Copenhagen: WHO – Regional Office for Europe. Zugriff am 23. November 2020, auf http://www.euro.who.int/de/publications/abstracts/the-health-and-well-being-of-men-in-the-who-european-region-better-health-through-a-gender-approach-2018 Yousaf, O., Grunfeld, E. A. & Hunter, M. S. (2015). A systematic review of the factors associated with delays in medical and psychological help-seeking among men, Health Psychology Review, 9(2), 264–276. https://doi.org/10.1080/17437199.2013.840954 |
| Bemerkungen | Liebe Student*innen Gemäss Information der Universität Basel am Freitag, 15. Januar 2021 starten wir das Frühjahrssemester 2021 (FS 2021), wegen der anhaltend angespannten epidemiologischen Situation, mit vollständigem Online-Unterricht. Deshalb beginnt das Seminar 'Gender' und 'Medizin' am Montag, 1. März 2021 um 10:15 Uhr online. Einen entsprechenden Link per Zoom schicke ich Ihnen gerne bis zum Montag, 22. Februar 2021 zu. Gerne zu Ihrer weiteren Information: Sollte ein Präsenzunterricht während des FS 2021 wieder möglich sein, wird das Seminar in hybrider Form bis zur letzten Seminarsitzung am Montag, 31. Mai 2021 angeboten, als online und in Präsenz. Ich wünsche Ihnen bis zum Start des Seminars eine gute Zeit und Gesundheit. Bei Fragen erreichen Sie mich gerne per E-Mail und auf dem Mobiltelefon unter der Nummer: +41(0)76 327 78 88. Herzliche Grüsse Frank Luck |
| Teilnahmevoraussetzungen | - Regelmässige Teilnahme: Nicht mehr als 2 Absenzen. Es wird eine Anwesenheitsliste geführt. - Lektüre der obligatorischen Texte. - Aktive Teilnahme am Seminar. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Montag | 10.15-11.45 | - Online Präsenz - |
Einzeltermine
| Datum | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Montag 01.03.2021 | 10.15-11.45 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Montag 08.03.2021 | 10.15-11.45 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Montag 15.03.2021 | 10.15-11.45 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Montag 22.03.2021 | 10.15-11.45 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Montag 29.03.2021 | 10.15-11.45 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Montag 05.04.2021 | 10.15-11.45 Uhr | Ostern |
| Montag 12.04.2021 | 10.15-11.45 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Montag 19.04.2021 | 10.15-11.45 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Montag 26.04.2021 | 10.15-11.45 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 102 |
| Montag 03.05.2021 | 10.15-11.45 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 102 |
| Montag 10.05.2021 | 10.15-11.45 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 102 |
| Montag 17.05.2021 | 10.15-11.45 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 102 |
| Montag 24.05.2021 | 10.15-11.45 Uhr | Pfingstmontag |
| Montag 31.05.2021 | 10.15-11.45 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 102 |
| Module |
Modul: Methoden und Felder der Kulturanthropologie (Bachelor Studienfach: Kulturanthropologie) Modul: Research Lab Kulturanthropologie (Master Studienfach: Kulturanthropologie) Modul: Themenfelder der Geschlechterforschung (Bachelor Studienfach: Geschlechterforschung) Modul: Vertiefung Themenfelder der Geschlechterforschung (Master Studienfach: Geschlechterforschung) Vertiefungsmodul (Transfakultäre Querschnittsprogramme im freien Kreditpunkte-Bereich) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Gruppenpräsentation (mündlich): Gruppenpräsentationen: Dauer maximal 20 Minuten, Referat in Teams (bis zu sechs Student*innen) zu einem gewählten Thema im Bereich ‚Gender‘ und ‚Medizin‘. Bitte planen Sie mindestens 20 Minuten für Fragen und Diskussion im Anschluss an das Referat ein. Die Gesamtzeit der Gruppenpräsentationen sollte nicht länger als 40 Minuten betragen. Kriterien zur Beurteilung der Gruppenpräsentation: - Das gewählte Thema hat einen Bezug zum Seminar: ‚Gender‘ und ‚Medizin‘. - Die Ausgangsfragestellung bzw. die Ausgangsfragestellungen sind nachvollziehbar. - Die Ergebnisse und/oder die Thesen Ihrer Arbeit sind präzise und verständlich präsentiert. - Die Ergebnisse und/oder die Thesen Ihrer Arbeit werden im Rahmen der Gruppenpräsentation konstruktiv-kritisch diskutiert. - Das Fazit zur Bearbeitung Ihrer Fragestellung ist formuliert. - Das Handout zur Gruppenpräsentation (maximal 15 Seiten) bildet die Bearbeitung des gewählten Themas ab. - Die Regeln zum Zitieren von Literatur werden gemäss der jeweiligen Studienrichtung im Handout eingehalten. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | Pass / Fail |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Gender Studies |