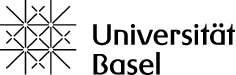Zurück zur Auswahl
60780-01 - Proseminar: Religiöse Dinge. Die Materielle Kultur des Glaubens in der Frühen Neuzeit (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2021 |
| Angebotsmuster | einmalig |
| Dozierende | Arno Haldemann (arno.haldemann@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Vormoderne Religiosität war untrennbar mit Objekten – Reliquien, Devotionalien, Gebäuden, Büchern, Bildern, Körpern – verbunden. Sie waren Gegenstand von Andachten und Erbauung, aber auch konfessioneller Polemik, Zurückweisung und Bekämpfung. In der Auffassung von Gläubigen sorgten sie ausserdem für Schutz, Heil und Segen. Daher übten sie zum Teil eine grosse Anziehung aus, die diese Menschen in Form von Pilgerreisen, Wallfahrten und Prozessionen in Bewegung zu versetzen vermochte. Religiöse Inhalte und Differenzen wurden an ihnen auf sinnliche Weise sicht- und erfahrbar. Gleichzeitig konnten sie an wichtige Ereignisse im Lebenslauf – Taufe, Hochzeit und Tod – erinnern. Kurz: Frühneuzeitliche Religiosität unterlag massgeblich materiellen Bedingungen und Effekten. Somit sind religiöse Objekte zentrale „Koproduzenten von Wirklichkeit“ (Derix et al., 2016, S. 389) und Zeugen frühneuzeitlicher Glaubenspraxis. Durch diese Perspektive werden sie zu wichtigen historische Quellen, so die Grundannahme in diesem Proseminar. In der Veranstaltung fragen wir nach dem Verhältnis von Religion und materieller Kultur in der Frühen Neuzeit und gehen dem materiellen Ausdruck und Bezugspunkt religiöser Praktiken nach. Ein Fokus wird dabei auf sakralen Gegenständen der katholischen Frömmigkeit liegen. Es wird aber auch der Frage nach materiellen Sinnbezügen bzw. deren Abwesenheit in den protestantischen Konfessionen nachgegangen. Auch Objekte des sogenannten ‚Volksglaubens‘ sollen einbezogen werden, um die materielle Dimension frühneuzeitlichen Glaubens einzufangen. Im ersten Teil der Veranstaltung werden wir uns vor allem mit konzeptionellen Texten und theoretischen Auseinandersetzungen des material turns beschäftigen, um uns den historischen Zugängen zu der materiellen Kultur der Frühen Neuzeit anzunähern. Im Kontext frühneuzeitlicher Religiosität gehen wir im zweiten Teil der Frage nach, „wie sich Praktiken und materielle Anordnungen gegenseitig konstituieren“ (Rieske, 2015, S. 293). Dabei werden wir anhand von Quellen und Sekundärliteratur konkreten historischen Subjekt-Objekt-Konstellationen und -interaktionen nachgehen. |
| Lernziele | Neben der inhaltlichen Beschäftigung mit der Thematik und aktuellen Debatten in der Auseinandersetzung mit material culture üben wir grundlegende geschichtswissenschaftliche Arbeitstechniken und machen uns mit spezifischen Hilfsmitteln der Disziplin vertraut. Ziel der Veranstaltung ist die Heranführung der Studierenden an den Schreibprozess einer Proseminararbeit. |
| Literatur | Siebenhüner, Kim, Things That Matter. Zur Geschichte der materiellen Kultur in der Frühneuzeitforschung, in: Zeitschrift für Historische Forschung 42 (2015), 373–409. Rieske, Constantin, All the small things. Glauben, Dinge und Glaubenswechsel im Umfeld der Englischen Kollegs im 17. Jahrhundert, in: Praktiken der Frühen Neuzeit. Akteure, Handlungen, Artefakte, hrsg. v. Arndt Brendecke, Köln, Weimar, Wien 2015, 292–304. Cress, Torsten, Art. Religiöse Dinge, in: Handbuch Materielle Kultur. Bedeutungen, Konzepte, Disziplinen, hrsg. v. Stefanie Samida/Manfred K. H. Eggert/Hans Peter Hahn, Stuttgart, Weimar 2014, 241–244. Füssel, Marian, Die Materialität der Frühen Neuzeit. Neuere Forschungen zur Geschichte der materiellen Kultur, in: Zeitschrift für Historische Forschung 42 (2015), 433–463. Hahn, Hans Peter, Materielle Kultur? Fragestellungen, Entwicklungen, Potenziale, in: MEMO Medieval and Early Modern Material Culture Online 5 (2019), 5–19. Derix, Simone/Gammerl, Benno/Reinecke, Christiane/Verheyen, Nina, Der Wert der Dinge. Zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Materialitäten, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 13 (2016), 387–403. |
| Bemerkungen | Aufgrund der nicht absehbaren Infektionslage wird diese Lehrveranstaltung in digitaler Form geplant. Ggf. wird das Lehrformat im Verlauf des Semesters durch hybride oder Präsenzelemente ergänzt. |
| Teilnahmevoraussetzungen | Für Studierende des BSF Geschichte im Grundstudium mit abgeschlossenem Einführungskurs Geschichte. Teilnahme an der ersten Sitzung ist obligatorisch. Die Teilnehmerzahl ist auf 24 beschränkt. Bei Überbelegung werden Studierende des BSF Geschichte, die noch kein Proseminar in dem Modul absolviert haben, bevorzugt zugelassen. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Freitag | 14.15-16.00 | - Online Präsenz - |
Einzeltermine
| Datum | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Freitag 05.03.2021 | 14.15-16.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Freitag 12.03.2021 | 14.15-16.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Freitag 19.03.2021 | 14.15-16.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Freitag 26.03.2021 | 14.15-16.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Freitag 02.04.2021 | 14.15-16.00 Uhr | Ostern |
| Freitag 09.04.2021 | 14.15-16.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Freitag 16.04.2021 | 14.15-16.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Freitag 23.04.2021 | 14.15-16.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Freitag 30.04.2021 | 14.15-16.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Freitag 07.05.2021 | 14.15-16.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Freitag 14.05.2021 | 14.15-16.00 Uhr | Auffahrt |
| Freitag 21.05.2021 | 14.15-16.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Freitag 28.05.2021 | 14.15-16.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Freitag 04.06.2021 | 14.15-16.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Module |
Modul: Basis Frühe Neuzeit (Bachelor Studienfach: Geschichte) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Aktive Teilnahme. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | Pass / Fail |
| Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Departement Geschichte |