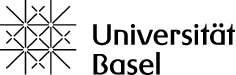Zurück zur Auswahl
62366-01 - Seminar: Reichtum, Macht und glokale Verflechtung (3 KP)
| Semester | Herbstsemester 2021 |
| Angebotsmuster | einmalig |
| Dozierende | Ganga Jeyaratnam (g.jey@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Jede*r 15te Milliardär*in weltweit lebt angeblich in der Schweiz, hat hier ein steuergünstiges Domizil, ist als internationaler Unternehmer aktiv oder fördert als Mäzenin Kulturschaffende. Im Seminar nähern wir uns dem Reichtum und seinen Implikationen aus mehreren Perspektiven: Wir analysieren soziale Ungleichheit und ungleiche Lebenschancen – messbar am Einkommen und Vermögen, an Bildung, beruflicher Stellung, Wohnsituation, Gesundheit und Lebenserwartung – aus der Perspektive des zunehmenden Reichtums und was dies für Armut bedeutet. Das ermöglicht es uns auch, zu diskutieren, wie ökonomisches, soziales, kulturelles und Macht-Kapital zusammenwirken. Wir erörtern, wie die Struktur der Schweiz als kleines Land, offene Gesellschaft und international verflochtene Volkswirtschaft sich auf glokaler Ebene – global und lokal – auswirkt. Dazu zwei Beispiele: 1) In der Schweiz domizilierte Unternehmen und Aktionär*innen sind im weltumspannenden Rohstoffgeschäft ganz vorne mit dabei. Die Rhizome dieses Geflechts reichen von Chile über Sambia bis nach China und je wieder nach Genf, Zug oder ins Tessin, wo sie auch mit der Versicherungsbranche, dem FinTech-Cluster, Kryptowährungen sowie der lokalen Kultur- und Sportunterstützung zusammenhängen. Beispiel 2): Der „Schweizer“ Reichtum konzentriert sich nicht nur in Städten wie Basel, Genf oder Zürich: Einkommenskonzentrationen und Vermögensballungen finden sich auch in kleineren Gemeinden (bspw. im waadtländischen Vaux-sur-Morges, wo ein Basler Pharma-Erbe lebt, oder im schwyzerischen Bezirk Höfe) sowie in ländlich-touristischen Gebirgsregionen wie St. Moritz, Gstaad oder Verbier. Was bedeutet dies fürs Stadt-Land-Verhältnis? Als Studierende stellen Sie nicht nur theoretische und empirische, sondern auch praktische Bezüge zum Reichtum her, indem sie dessen glokalen Verflechtungen und Implikationen sozial- und kulturwissenschaftlich auf den Grund gehen. |
| Lernziele | Studierende eignen sich das Wissen um Fakten, Methoden und Theorien zu sozialer Ungleichheit an. Sie erwerben die Fähigkeit für evidenzbasiertes kritisches Denken und erkennen gesellschaftliche Zusammenhänge. Studierende können eigenständig Recherchen und kleinere empirische Untersuchungen durchführen und die Ergebnisse adäquat synthetisieren. |
| Literatur | Bourdieu, Pierre, 2005: Ökonomisches Kapital — Kulturelles Kapital — Soziales Kapital. S. 49–79. In: Steinrücke, Margareta, Pierre Bourdieu: Die verborgenen Mechanismen der Macht. Hamburg: VSA Verlag. Dimmel, Nikolaus u.a. (Hg.), 2017: Handbuch Reichtum. Neue Erkenntnisse aus der Ungleichheitsforschung, Innsbruck etc.: Studien Verlag; Forrest, Ray, Sin Yee Koh, Bart Wissink (Hg.) 2018: Cities and the Super-Rich. Real estate, Elite practices, and Urban Political Economies, New York: Palgrave Macmillan; Mäder, Ueli, Ganga Jey Aratnam und Sarah Schilliger, 2010: Wie Reiche denken und lenken: Reichtum in der Schweiz: Geschichte, Fakten, Gespräche. Zürich: Rot-punktverlag; Sassen, Saskia, 2019: Cities in a World Economy. Los Angeles: SAGE. (5. aktualisierte Auflage). |
| Teilnahmevoraussetzungen | Grundstudium abgeschlossen. Die Teilnehmerzahl ist aus Gründen der Qualitätssicherung der Lehre auf 25 beschränkt. Die Teilnehmenden werden nach Fachrichtung, Studiengang und in der Reihenfolge ihrer Anmeldung auf die Liste gesetzt. Wer im Rahmen von Auslandsaufenthalten und von Austauschprogrammen in Basel studiert, wird unabhängig vom Listenplatz immer aufgenommen. |
| Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Anmelden: g.jey@unibas.ch; Belegen auf MOnA. Lehrveranstaltungen mit beschränkter Teilnehmerzahl können ab 01.08.2021 bis 01.09.2021 über MOnA belegt werden. Die Zuteilung erfolgt durch die Dozierenden. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Dienstag | 10.15-12.00 | Alte Universität, Seminarraum -201 |
Einzeltermine
| Datum | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Dienstag 28.09.2021 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum -201 |
| Dienstag 05.10.2021 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum -201 |
| Dienstag 12.10.2021 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum -201 |
| Dienstag 19.10.2021 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum -201 |
| Dienstag 26.10.2021 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum -201 |
| Dienstag 02.11.2021 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum -201 |
| Dienstag 09.11.2021 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum -201 |
| Dienstag 16.11.2021 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum -201 |
| Dienstag 23.11.2021 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum -201 |
| Dienstag 30.11.2021 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum -201 |
| Dienstag 07.12.2021 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum -201 |
| Dienstag 14.12.2021 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum -201 |
| Dienstag 21.12.2021 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum -201 |
| Module |
Modul: Methoden und Felder der Kulturanthropologie (Bachelor Studienfach: Kulturanthropologie) Modul: Research Lab Kulturanthropologie (Master Studienfach: Kulturanthropologie) Modul: Theorien der Kulturanthropologie (Bachelor Studienfach: Kulturanthropologie) Modul: Theorien und Methodologien der Kulturanthropologie (Master Studienfach: Kulturanthropologie) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Regelmässige und aktive Teilnahme. Die Leistungsüberprüfung findet in Form von Beiträgen im Forum bzw. der Präsentation von empirischen Aufträgen (Erhebung, Umfrage/Interviews) statt. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | Pass / Fail |
| Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie |