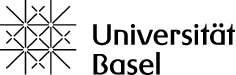Zurück zur Auswahl
62612-01 - Seminar: Press Start – Linguistische Zugänge zu digitalem Spiel (3 KP)
| Semester | Herbstsemester 2021 |
| Angebotsmuster | einmalig |
| Dozierende | Hiloko Kato (hiloko.kato@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Digitale Spiele sind in jüngster Zeit immer mehr aus ihrem populären Schattendasein herausgetreten und sind vor kurzem auch von Politik und Kultur als ernstzunehmende Medienform anerkannt worden: So spricht Kanzlerin Angela Merkel an der Gamescom 2017 von digitalen Spielen als »Innovationsmotor« und »Kulturgut«, an den Olympischen Spiele in Tokyo finden zum ersten Mal Esport-Turniere statt und seit 2019 nimmt das Literaturarchiv Marbach digitale Spieltitel in ihre Sammlung auf. Gerade aus der Corona-Pandemie wird die Gamebranche als einige der wenigen mit Gewinnzuwachs hervorgehen und kann sich mittlerweile sogar der Unterstützung durch die WHO (die sich bisher vornehmlich mit der Suchtthematik betreffend digitaler Spiele beschäftigt hat) bei der im März 2020 lancierten internationalen Kampagne #PlayApartTogether erfreuen, das zum Ziel hatte, über Kanäle der Gaming-Community und kostenlosen Angebote die Botschaften der Weltgesundheitsorganisation zu verbreiten. Damit wird umso deutlicher, dass digitales Spiel nicht mehr als einsame Tätigkeit jugendlicher ‘Nerds’ anzusehen ist, sondern mittlerweile zu einer alltäglichen Beschäftigung vieler geworden ist. Trotz dieser Entwicklung und dem einschlägigen Forschungsfeld der Game Studies, die sich seit 2000 etabliert und die auch massiv an wissenschaftlichem Output zugelegt hat, liegen digitale Spiele immer noch im Zuständigkeitsbereich von Film-, Literatur-, Medienwissenschaft und Psychologie. Demgegenüber gibt es bislang von linguistischer Seite her relativ wenige Arbeiten, die sich mit digitalen Spielen beschäftigen. Die Linguistik bietet indes vielversprechende Theorien (z.B. nebst den bereits zur Anwendung kommenden gesprächsanalytischen auch aktuelle textlinguistische, soziolinguistische und natürlich auch übergeordnet semiotische Ansätze), um das allgegenwärtige und keineswegs mehr zu trivialisierende neue Medium zu erforschen. Wie dies im konkreten Fall möglich ist, soll in diesem Seminar anhand linguistischer Analysen zu unterschiedlichen Games und deren Epitexten erprobt und diskutiert werden. Theoretische Inputs und empirische Arbeit werden sich in den Sitzungen abwechseln. Game-Erfahrung ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung. |
| Lernziele | Die Studierenden kennen die im Seminar behandelten einschlägigen Texte zu digitalem Spiel in den Game Studies und in der Linguistik und können digitale Spiele mit den im Seminar vermittelten linguistischen Ansätzen analysieren. |
| Literatur | Huizinga, Johan (1987/1938): Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. Caillois, Roger (2017/1960): Die Spiele und die Menschen. Berlin: Matthes & Seitz Verlag. Salen, Katie/Zimmerman, Eric (Hrsg.) (2005): The Game Design Reader. Cambridge: MIT Press. GamesCoop (Hrsg.) (2013): Theorien des Computerspiels. Junius: Hamburg. Aarseth, Espen J. (1997): Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: The John Hopkins University Press. Juul, Jesper (2005): half-real. Video Games between Real Rules and Fictional Worlds. Cambridge: MIT Press. Reeves, Stuart/Greiffenhagen, Christian /Laurier, Eric (2016): Video gaming as Practical Accomplishment: Ethnomethodology, Conversation Analysis, and Play. In: Topics in Cognitive Science 9, Nr. 2, 308–342. Kato, Hiloko/Bauer, René (2016): Hänsel und Gretel. Konstruktion und Rezeption von Orientierungshinweisen im Spielraum. In: Hennig, Martin/Krah, Hans (Hrsg.): Spielzeichen – Theorien, Analysen, Kontexte des zeitgenössischen Computerspiels. Bolzenburg: Werner Hülsbusch Verlag, 308–330. Kato, Hiloko (im Erscheinen): Gefährte, Haustier oder Spielobjekt? Analysen des Umgangs mit virtuellen Tieren an und ausgehend vom digitalen Spiel ‚The Last Guardian‘. In: Schmidt-Jüngst, Miriam (Hrsg.): Mensch – Tier – Maschine. Sprachliche Praktiken an und jenseits der Außengrenze des Humanen. Bielefeld: transcript, 245–283. |
| Teilnahmevoraussetzungen | Abgeschlossenes Grundstudium (inkl. Proseminar-Arbeit) sowie erfolgreicher Besuch des Seminars ‚Allgemeine Sprachwissenschaft‘ Aus Gründen der Qualitätssicherung ist die Platzzahl in diesem Seminar auf 25 Personen begrenzt. Bei mehr als 25 Buchungen werden Studierende der Germanistik bevorzugt; zudem wird die Reihenfolge der Anmeldung berücksichtigt. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Montag | 12.15-14.00 | Kollegienhaus, Seminarraum 212 |
Einzeltermine
| Datum | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Montag 20.09.2021 | 12.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 212 |
| Montag 27.09.2021 | 12.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 212 |
| Montag 04.10.2021 | 12.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 212 |
| Montag 11.10.2021 | 12.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 212 |
| Montag 18.10.2021 | 12.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 212 |
| Montag 25.10.2021 | 12.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 212 |
| Montag 01.11.2021 | 12.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 212 |
| Montag 08.11.2021 | 12.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 212 |
| Montag 15.11.2021 | 12.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 212 |
| Montag 22.11.2021 | 12.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 212 |
| Montag 29.11.2021 | 12.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 212 |
| Montag 06.12.2021 | 12.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 212 |
| Montag 13.12.2021 | 12.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 212 |
| Montag 20.12.2021 | 12.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 212 |
| Module |
Modul: Aufbaustudium Deutsche Sprachwissenschaft (Bachelor Studienfach: Deutsche Philologie) Modul: Disziplinäre Vertiefung (Bachelor Studienfach: Deutsche Philologie) Modul: Forschungspraxis und Vertiefung (Master Studiengang: Sprache und Kommunikation) Modul: Interphilologie: Sprachwissenschaft BA (Bachelor Studienfach: Englisch) Modul: Interphilologie: Sprachwissenschaft BA (Bachelor Studienfach: Deutsche Philologie) Modul: Interphilologie: Sprachwissenschaft BA (Bachelor Studienfach: Französistik) Modul: Interphilologie: Sprachwissenschaft BA (Bachelor Studienfach: Hispanistik) Modul: Interphilologie: Sprachwissenschaft BA (Bachelor Studienfach: Italianistik) Modul: Interphilologie: Sprachwissenschaft BA (Bachelor Studienfach: Nordistik) Modul: Interphilologie: Sprachwissenschaft MA (Master Studienfach: Slavistik) Modul: Interphilologie: Sprachwissenschaft MA (Master Studienfach: Englisch) Modul: Interphilologie: Sprachwissenschaft MA (Master Studienfach: Deutsche Philologie) Modul: Interphilologie: Sprachwissenschaft MA (Master Studienfach: Französistik) Modul: Interphilologie: Sprachwissenschaft MA (Master Studienfach: Hispanistik) Modul: Interphilologie: Sprachwissenschaft MA (Master Studienfach: Italianistik) Modul: Interphilologie: Sprachwissenschaft MA (Master Studienfach: Latinistik) Modul: Interphilologie: Sprachwissenschaft MA (Master Studienfach: Nordistik) Modul: Sprache als Prozess (Master Studiengang: Sprache und Kommunikation) Wahlbereich Master Deutsche Philologie: Empfehlungen (Master Studienfach: Deutsche Philologie) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Mitwirkung in einer Arbeitsgruppe, die sich mit einem spezifischen, von dem/der Teilnehmer*in selber gewählten Thema näher auseinandersetzt und ihre Erkenntnisse für die Diskussion in einer Sitzungsleitung vorbereitet (inkl. Handout und aufbereitete Daten); mehrere kleinere über das Semester verteilte blended-learning Arbeitsaufträge zu Lektüren und Material |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | Pass / Fail |
| Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft |