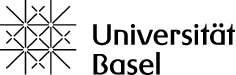Zurück zur Auswahl
62689-01 - Seminar: Entwicklungspfade der Weltgesellschaft: Globalisierung, Deglobalisierung, Planetarisierung? (3 KP)
| Semester | Herbstsemester 2021 |
| Angebotsmuster | einmalig |
| Dozierende | Davor Löffler (davor.loeffler@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Die Globalisierung tritt derzeit in eine neue Phase über, vor dem Hintergrund der longue durée der neuzeitlichen Expansionen (ab 1500) in die fünfte Großphase, unter der engeren Definition als erdraumumfassende wirtschaftliche Verflechtung konsolidiert durch internationale Institutionen (ab 1900) in die vierte Phase. Eine wesentliche Ursache für diesen Phasenwechsel ist wiederum die Technologieentwicklung, speziell die Informationstechnologie: Einerseits beschleunigt sie in vielen Bereichen die charakteristische Raum-Zeit-Schrumpfung, erweitert die Netzwerkbildung und trägt zu einer fulminanten Steigerung und Verästelung globaler Interaktionen bei, andererseits jedoch reduziert sie an einigen Stellen paradoxerweise die Notwendigkeit globalen Austauschs und zeitigt rückläufige, deglobalisierende Effekte, etwa aufgrund der zunehmenden Ineffizienz der Auslagerung von Arbeit durch Automatisierung. Hiermit verwoben ist der Aufstieg neuer global player, allen voran Chinas, der die historisch vom Westen ausgehend etablierten inter- und transnationalen Institutionen zunehmend in Bedrängnis geraten lässt und absehbar zu Rekonstitutionen des Weltsystems führen wird. Der Klimawandel stellt die Welt vor die doppelte Herausforderung lokaler und globaler Transformation: Pfadabhängig festgefahrene Strukturen (etwa Verteilungs- und Produktionsformen) und Werte (etwa Wachstumsvorstellungen) müssen als solche identifiziert und lokal umstrukturiert werden, während dies zugleich nicht ohne weltweite Koordination und eine signifikante Vertiefung der Kooperation möglich ist. Wohin also bewegt sich die Weltgesellschaft? Stehen wir vor dem Übergang vom „Globalen“ zum „Planetaren“? In diesem Seminar soll der Umbruch in die neue Globalisierungsphase grundlegend aufgearbeitet und mit Blick auf die anstehenden Herausforderungen untersucht werden. Ausgehend von der Klärung des Begriffs und der Geschichte der Globalisierung bzw. Weltgesellschaft zielt das Seminar auf die Reflexion und Bewertung aktueller Szenarien der zukünftigen Welt. Wie ist das Konzept bzw. die Möglichkeit einer Weltgesellschaft einzuschätzen? Auf welchen Ebenen ist sie etabliert, auf welchen nicht? Wie wirkt sich das Spannungsverhältnis von Homogenisierung und Heterogenisierung aus? Welche Rolle spielt die Technologie? Wie ändern sich Raum- und Zeitbegriffe? Ist die Globalisierung über ein Merkmal der (multiplen) Moderne hinaus auch als Phänomen der allgemeinen Technik- und Kulturevolution zu interpretieren und in makrogeschichtliche Trajektorien einzubetten? Wie realistisch sind Forderungen nach einer Transformation und auf welchen Ebenen und in welchen Bereichen wäre diese anzusetzen? Wie sind derzeit debattierte Szenarien wie die Weltregierung, postnationale oder postkompetitive Weltordnungen („Tianxia“), Technologische Zivilisation, Digitaler Sozialismus oder die Planetarisierung zu bewerten? |
| Literatur | Zugang zur Literatur folgt per Email. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| 14-täglich | Mittwoch | 10.15-14.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Einzeltermine
| Datum | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Mittwoch 22.09.2021 | 10.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
| Mittwoch 13.10.2021 | 10.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
| Mittwoch 20.10.2021 | 10.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
| Mittwoch 03.11.2021 | 10.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
| Mittwoch 17.11.2021 | 10.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
| Mittwoch 01.12.2021 | 10.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
| Mittwoch 15.12.2021 | 10.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
| Module |
Modul: Wirtschaft, Wissen und Kultur (Bachelor Studienfach: Soziologie) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Regelmäßige Teilnahme ist erforderlich, da die Inhalte der Sitzungen aufeinander aufbauen. Details zum Notenerwerb (Essay) werden in der ersten Sitzung besprochen. Es sollte zu jeder Sitzung (ab 22.10.) ein Gruppenreferat von 10-12 Minuten zu einem der vorgegebenen Themen gehalten werden. Die Teilnehmenden sollten a) je eine Zusammenfassung des bzw. der Seminartexte zu einer Sitzung erstellen (ca. 0,5-1 Seiten, Gegenstand/Erkenntnisinteresse des Textes und Kernaussagen, gerne auch stichpunktartig); b) zum selben Textmaterial drei weiterführende Forschungsfragen entwickeln. Zusammenfassung und Forschungsfragen sind einzureichen per Mail an den Dozenten zwei Tage vor der jeweiligen Sitzung (jeweils bis Montagabend). Details dazu folgen in der ersten Sitzung. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | Pass / Fail |
| Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Soziologie |