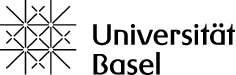Zurück zur Auswahl
64011-01 - Seminar: Medien des Kolonialismus (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2022 |
| Angebotsmuster | einmalig |
| Dozierende | Ute Holl (ute.holl@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Koloniale Regierungsformen sind ohne ihre je historische Medienformationen nicht zu denken: als Medien der Vermessung von Leuten und von Territorien, als mediale Dispositive der Identifizierung, der Verwaltung und des Transports, als Medien der Visualisierung, der Klassifizierung und des Archives, als Medienanordnungen der Überwachung und der Ökonomisierung. Medien systematisieren nicht nur, was sie aufnehmen, speichern und distribuieren — und dies im Kolonalien stets im Hinblick auf rassifizierende Kategorien — sondern sie erzeugen und legitimieren zunächst neue Wissensformationen, die als objektive und unhintergehbare ausgewiesen sein sollen. Daher spielen sie eine konstitutive Rolle in der Etablierung kolonialer Reiche. Und daher erweist sich Kolonialismus gerade in den selbst nicht wahrnehmbaren, impliziten Strukturen medialer Formationen als ausserordentlich resilient. Nicht zufällig fällt die «Hochphase der kolonialen Weltordnung zwischen etwa 1880 und 1960, die in ihren strukturellen Auswirkungen noch in die Gegenwart hineinreicht und in der öffentlichen Erinnerung besonders stark präsent ist» (Conrad 2021) mit der Durchsetzung der sogenannten alten «neuen Medien» zusammen: in der Kommunikation sind dies Telegraphie, Telefonie, Funk und Radio; in der Verwaltung Daktyloskopie, Fotogrammetrie und Fotografie; in der Anthropologie Film, Grammophon, Typewriter und, in der Nachkriegszeit schliesslich, der Computer, der Berechnungen von Bevölkerungen und deren Kontrolle beschleunigt. Das Verhältnis ist jedoch kein einseitiges: Medien entwickeln sich unter Bedingungen sozialer und politischer Verhältnisse und werden entsprechend ausdifferenziert. Bis in die 1970er Jahre gab es beispielsweise kein Filmmaterial, das dunkle Haut angemessen abbilden konnte. Gerade als Infrastruktur erhält sich der Rassismus in den Medien über jede Dekolonialisierung hinaus. Historische Formen des Kolonialismus von den frühen neuzeitlichen Formen des 15. Jahrhunderts bis zum Spätkolonialismus des 19. Jahrhunderts weisen freilich ganz unterschiedliche Charakteristiken auf. Techniken der territorialen Aneignung, der Regierung, der Ausbeutung und der rassistisch begründeten Unterdrückung werden mit je neuen Medien auch erneut produziert und legitimiert. Stets aber lassen sich konkrete Medienpraktiken und Kulturtechniken bestimmen, die koloniale Regierungsformen erst ermöglichen |
| Lernziele | In unserem Seminar werden wir im Hinblick auf gegenwärtige Debatten und Theorien des Postkolonialismus, die eben nicht das Ende, sondern vielmehr die Spätwirkungen kolonialer Macht konstatieren, an verschiedenen Beispielen untersuchen, wie Medien koloniale Verhältnisse als Wahrnehmungs- und Wissensformen begründet und stabilisiert haben. |
| Literatur | Eine Liste mit Texten und audiovisuellen Objekten, die nach kurzen Einführungen durch die Seminarteilnehmer*innen im Plenum diskutiert werden, wird zu Beginn des Seminars ausgegeben. Zum Nachweis einer erfolgreichen Teilnahme gehört ein Essay, der im Laufe des Seminars abgegeben werden soll. Für Interessierte zur Vorbereitung empfohlen: Nicholas Mirzoeff, The Right to Look. A Counterhistory of Visuality. Duke University Press, Durham and London 2011; Britta Lange, Gefangene Stimmen. Tonaufnahmen von Kriegsgefangenen aus dem Lautarchiv 1915-1918. Berlin 2019; Marc Sealy, Decolonizing the Camera. Photography in Racial Time. London 2019; Fatimah Tobing Rony, The third eye: Race, cinema, and ethnographic spectacle. Duke University Press 1995. |
| Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Anmeldung über MOnA notwendig (services.unibas.ch). |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Dienstag | 16.15-18.00 | Holbeinstrasse 12, Bluebox |
Einzeltermine
| Datum | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Dienstag 22.02.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Holbeinstrasse 12, Bluebox |
| Dienstag 01.03.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Holbeinstrasse 12, Bluebox |
| Dienstag 08.03.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Fasnachtsferien |
| Dienstag 15.03.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Holbeinstrasse 12, Bluebox |
| Dienstag 22.03.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Holbeinstrasse 12, Bluebox |
| Dienstag 29.03.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Holbeinstrasse 12, Bluebox |
| Dienstag 05.04.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Holbeinstrasse 12, Bluebox |
| Dienstag 12.04.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Holbeinstrasse 12, Bluebox |
| Dienstag 19.04.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Holbeinstrasse 12, Bluebox |
| Dienstag 26.04.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Holbeinstrasse 12, Bluebox |
| Dienstag 03.05.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Holbeinstrasse 12, Bluebox |
| Dienstag 10.05.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Holbeinstrasse 12, Bluebox |
| Dienstag 17.05.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Holbeinstrasse 12, Bluebox |
| Dienstag 24.05.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Holbeinstrasse 12, Bluebox |
| Dienstag 31.05.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Holbeinstrasse 12, Bluebox |
| Module |
Modul: Aufbaustudium Theoretische Perspektiven BA (Bachelor Studienfach: Medienwissenschaft) Modul: Europäisierung und Globalisierung (Masterstudium: European Global Studies) Modul: Materialitäten (Master Studiengang: Kulturtechniken) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | Pass / Fail |
| Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Medienwissenschaft |