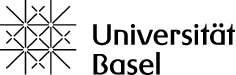Zurück zur Auswahl
70936-01 - Seminar: Die Alp. Erkundungen zu einer Wirtschafts- und Lebensweise zwischen Identitätsangebot und Sehnsuchtsort (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2024 |
| Angebotsmuster | einmalig |
| Dozierende | Konrad Kuhn (konrad.kuhn@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Vieh zum Sömmern auf hochgelegene Weiden zu treiben, ist eine weit zurückreichende Wirtschaftsweise. Sie ist als Teil einer komplexen Stufenwirtschaft eng verbunden mit der Milch- und Käseherstellung, aber auch mit den topografischen Gegebenheiten der Berglandschaft in den Alpen. Nicht nur (aber vielleicht besonders?) in der Schweiz ist „die Alp“ allerdings seit langem auch ein kulturell stark verankerter Sehnsuchtsort, der (nationale) Identität, kollektives Selbstverständnis und individuelle Vorstellungswelten berührt. Die Alpsaison wird dabei in oft sehr sehr gegensätzlicher Weise verhandelt: Einerseits steckt sie offenbar in der Krise, Arbeitskräfte sind oft nur schwierig zu finden, abgelegene Alpgebäude werden aufgegeben und die Veränderungen durch die Klimakrise sind tiefgreifend. Zunehmend werden nicht mehr nur Milch, Käse, Butter und Fleisch produziert, sondern eben auch eine spezifische „Landschaft“, deren Pflege finanziell vergütet wird. Andererseits erlebt „das Alpine“ einen Boom im Bereich des mit einem besonderen Qualitäts-Versprechen einhergehenden Konsums und der körperlich-kulinarischen Freizeitgestaltung. Damit wird „die Alp“ zum lokal verorteten, aber zugleich diffusen Bezugspunkt für Gefühle einer als verloren empfundenen Ursprünglichkeit und Einfachheit des Lebens. Diese seit der bürgerlichen Moderne hochwirksamen Imaginarien sind seither Bestandteil von Berg-Beziehungen und erleben vielfältige Aktualisierungen, in den 1970er-Jahren etwa in der Form von „Aussteiger“-Projekten oder als temporäre Auszeiten in der heutigen digitalen Gegenwart – und sei es nur als Vorstellungswelt. Die bis heute aktuelle kulturelle Produktivität der „Alpsaison“ zeigt sich exemplarisch etwa daran, dass die Schweiz 2023 diese spezifische Form der Berglandwirtschaft bei der Unesco zur Anerkennung als immaterielles Kulturerbe der Menschheit eingereicht hat. Das Seminar richtet den Blick auf das seit jeher komplexe Verhältnis zwischen Berg und Tal, befragt die (weit mehr als nur ökonomischen) Bedeutungsebenen der Alpwirtschaft, deren konkrete Praktiken und deren kulturelle Wirksamkeiten. Dabei vertiefen wir uns in einem ersten Schritt in die breit vorhandene Literatur und legen dabei (jenseits nationalistischer Argumente) einen besonderen Schwerpunkt auf die Schweiz. In einem zweiten Schritt identifizieren wir einzelne Themenbereiche „der Alp“, die wir in Kleingruppen vertiefend recherchieren. |
| Lernziele | Die Studierenden kennen kulturwissenschaftlich informierte Zugänge zur Alp und können sich in einem breiten Korpus relevanter Literatur orientieren. Die Studierenden reflektieren über gegenwärtige gesellschaftliche Debatten rund um die Alpwirtschaft (Landwirtschaftspolitik, Reduktion des Fleischkonsums, "Rückkehr" des Wolfs, ...) auf der Basis kulturanthropologischer Überlegungen. Die Studierenden entwickeln ein eigenständiges Themenfeld zu einem Teilbereich und vertiefen dieses in kulturanalytischer Perspektive. |
| Literatur | Wird bekanntgegeben, zur Einführung hilfreich: Asmussen, Tina (Hg.): Montan-Welten: Alpengeschichte abseits des Pfades. Zürich 2019. Tschofen, Bernhard: Wir Älpler. Mutmassungen über die Liebe zum saisonalen Leben in den Bergen. In: Alge, Daniela, Ursula Dünser (Hg.): Gamsfreiheit. Vom Älplerleben in Vorarlberg. Bregenz 2018, S. 220–228. Rest, Matthäus: Vom Almsommer zum Bauernherbst. Zum Wandel der bäuerlichen Welt in den Alpen. In: Luger, Kurt, Franz Rest (Hg.): Alpenreisen. Erlebnis, Raumtransformationen, Imagination. Innsbruck 2017, S. 345–364. |
| Teilnahmevoraussetzungen | Das Grundstudium muss abgeschlossen sein. Die Teilnehmenden werden nach Fachrichtung, Studiengang und in der Reihenfolge ihrer Anmeldung auf die Liste gesetzt. Wer im Rahmen von Auslandaufenthalten und von Austauschprogrammen in Basel studiert wird unabhängig vom Listenplatz immer aufgenommen. |
| Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Belegen in MoNA, keine zusätzliche Anmeldung per Email nötig. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Freitag | 10.15-12.00 | Alte Universität, Seminarraum 207 |
Einzeltermine
| Datum | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Freitag 01.03.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum 207 |
| Freitag 08.03.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum 207 |
| Freitag 15.03.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum 207 |
| Freitag 22.03.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum 207 |
| Freitag 29.03.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Ostern |
| Freitag 05.04.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum 207 |
| Freitag 12.04.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum 207 |
| Freitag 19.04.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum 207 |
| Freitag 03.05.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum 207 |
| Freitag 10.05.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Auffahrt |
| Freitag 17.05.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum 207 |
| Freitag 24.05.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum 207 |
| Freitag 31.05.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Alte Universität, Seminarraum 207 |
| Module |
Modul: Methoden und Felder der Kulturanthropologie (Bachelor Studienfach: Kulturanthropologie) Modul: Praktische Kulturanthropologie BA (Bachelor Studienfach: Kulturanthropologie) Modul: Praktische Kulturanthropologie MA (Master Studienfach: Kulturanthropologie) Modul: Research Lab Kulturanthropologie (Master Studienfach: Kulturanthropologie) Modul: Transfer: Europa interdisziplinär (Master Studiengang: Europäische Geschichte in globaler Perspektive ) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Regelmässige und aktive Teilnahme. Individueller Textinput, vertiefender thematischer Input/Referat im Seminar. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | Pass / Fail |
| Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie |