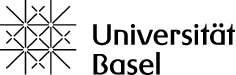Zurück zur Auswahl
60379-01 - Seminar: Bourdieu und Bildung (2 KP)
| Semester | Herbstsemester 2025 |
| Angebotsmuster | Jedes Herbstsemester |
| Dozierende | Luca Preite (luca.preite@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | In seinen Schriften beschäftigt sich Pierre Bourdieu wiederkehrend mit der Bildung als eine soziale Praxis, die gesellschaftliche Verhältnisse sowohl zu reproduzieren wie auch zu reflektieren und zu verändern vermag. Diese zweifache Perspektive steht mitunter beispielhaft für sein soziologisches Schaffen und seinen Werdegang. Aufgewachsen im ländlichen Béarn – sein Vater war Postangestellter, seine Mutter Hausfrau; beide stammten sie aus Pächterfamilien – verdankt Bourdieu seinen sozialen Aufstieg über das lycee und die école normal supérieure bis hin zu seiner Berufung ans Collège de France dem französischen Bildungssystem. Nichtsdestotrotz oder vielleicht genau deshalb blieb ihm, wie er in seinem soziologischen Selbstversuch rückblickend schreibt, stets eine «zwiespältige, widersprüchliche Beziehung zur Schule» (Bourdieu, 2002, S. 113) erhalten; eine «Mischung aus Auflehnung und Unterwerfung, Abstand und Erwartung», die sich auch deutlich in Vorbehalten gegenüber eines zur Schau gestellten Intellektualismus äussert. Vor diesem Hintergrund lesen und diskutieren wir im Seminar gemeinsam Bildungstexte von Pierre Bourdieu. Angefangen bei les héritiers (Bourdieu und Passeron, 1964) – im Deutschen übersetzt als Illusion der Chancengleichheit und die Erben (Bourdieu und Passeron, 2007), bis hin zu den feinen Unterschieden (Bourdieu, 2007), dem Homo Academicus und eventuell auch dem Staatsadel (Bourdieu, 2004) setzen wir uns im Seminar auch mit unbekannteren Texten auseinander, in denen Bourdieu zusammen mit Kollegen und Kolleginnen die Reproduktionsweisen von Bildungssystemen analysiert. Entscheidend nach Joseph Jurt (2003; 2008) und Franz Schultheiss (2007, 2019) – zwei der renommiertesten Bourdieu-Kenner im deutschsprachigen Raum – ist es dabei, Bourdieu kontextualisiert zu lesen. Gemieint ist damit, dass die Texte in ihren jeweiligen Entstehungsgeschichten und Entstehungszeiträumen gedeutet werden. Nur in solch einer verstehenden Perspektive könnte womöglich auch sichtbar werden, inwiefern und wie genau in der bourdieuschen Bildungskritik immer auch ein Moment der pädagogischen (Selbst-)Befähigung – Bourdieu spricht hierzu von einer rationalen Pädagogik, die möglichst versucht, «allen das zu geben, was einige ererbt haben» (Bourdieu, 2001, S. 24) – inhärent ist. |
| Lernziele | Die Studierenden deuten und verstehen die ausgewählten Bourdieu-Texte in ihren jeweiligen Entstehungsgeschichten und Entstehungszeiträumen und können darüber hinaus Übertragungen bzw. Analysen zu heutigen Verhältnissen herstellen. |
| Literatur | Bourdieu, Pierre. (2001). Wie die Kultur zum Bauern kommt. Hamburg: VSA. Bourdieu, Pierre. (2002). Ein soziologischer Selbstversuch. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Bourdieu, Pierre. (2004). Der Staatsadel. Konstanz: UVK. Bourdieu, Pierre. (2007). Die feinen Unterschiede Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Bourdieu, Pierre & Jurt, Joseph. (2003). Absolute Pierre Bourdieu. Freiburg i.Br.: Orange-Press. Bourdieu, Pierre & Passeron, Jean-Claude. (1964). Les héritiers. Les étudiants et la culture. Paris: Les éditions de Minuit. Bourdieu, Pierre & Passeron, Jean-Claude. (2007). Die Erben. Studenten, Bildung und Kultur. Konstanz: UVK. Jurt, Joseph. (2008). Bourdieu. Stuttgart: Reclam. Schultheis, Franz. (2007). Bourdieus Wege in die Soziologie : Genese und Dynamik einer reflexiven Sozialwissenschaft: Konstanz : UVK. Schultheis, Franz. (2019). Unternehmen Bourdieu. Ein Erfahrungsbericht. Bielefeld: transcript Verlag. |
| Bemerkungen | WICHTIG: Das Seminar findet neu als Blockseminar statt. Die Veranstaltungsdaten sind Fr/Sa 5. & 6.12.2025 |
| Weblink | https://bildungswissenschaften.unibas.ch |
| Teilnahmevoraussetzungen | BA-Abschluss. Immatrikuliert im Masterstudiengang Educational Sciences oder Fachdidaktik bzw. Doktoratsprogramm IBW. Studierende anderer Studiengänge wenden sich bei Interesse bitte zuerst an die Dozierenden. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| Block | Siehe Einzeltermine | ||
| Bemerkungen |
WICHTIG: Das Seminar findet neu als Blockseminar statt. Die Veranstaltungsdaten sind Fr/Sa 5. & 6.12.2025 |
Einzeltermine
| Datum | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Freitag 05.12.2025 | 14.15-17.45 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 105 |
| Samstag 06.12.2025 | 09.15-16.45 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 105 |
| Module |
Modul: Bildungs- und Erziehungsphilosophie (Masterstudium: Educational Sciences) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Anwesenheit (100%) - aktive Teilnahme an der Lehrveranstaltung (Vorbereitungstexte sind gelesen, Auf- und Nachbereitungsarbeiten erledigt) - ein mündlicher oder schriftlicher Seminarbeitrag als Einzel- oder Gruppenarbeit zu einem Thema Ihrer Wahl. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmelden: Belegen; Abmelden: Dozierende |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | Pass / Fail |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Institut für Bildungswissenschaften, bildungswissenschaften@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Institut für Bildungswissenschaften |