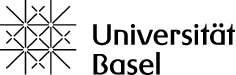Zurück zur Auswahl
21411-01 - Seminar: Lost in Transition: Die Kinder der Basler Mission (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2009 |
| Angebotsmuster | einmalig |
| Dozierende | Dagmar Konrad (dagmar.konrad@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Seit 1870 befindet sich die Basler Mission (heute mission 21) in der Missionsstraße hinter dem Spalentor. Von hier reisten die so genannten Missionsbräute ins ferne Indien, Afrika und China. Und hierher kamen später ihre dort geborenen Kinder zurück - ohne Eltern. Bei den meisten Missionsgesellschaften war es gängige Praxis, dass Missionsehepaare ihre Kinder im schulpflichtigen Alter, häufig sogar noch früher, zur weiteren Ausbildung nach Europa zu senden hatten. So auch im Falle der Basler Mission, einer der größten pietistisch geprägten Missionsgesellschaften des 19. Jahrhunderts. Die Missionskinder wuchsen im Kinderhaus der Basler Mission, in Bildungsanstalten in Süddeutschland oder bei Verwandten auf. Eltern und Kinder lebten fortan getrennt voneinander auf unterschiedlichen Kontinenten und in unterschiedlichen Kulturen. Die Kommunikation konnte nur noch in brieflicher Form erfolgen. Fremdsein und Entfremdung in Bezug auf die Enkulturation zieht sich als Konstante durch die Kindheits- und späteren Erwachsenenbiographien. Das Leben in zwei oder mehr Kulturen und die daraus resultierende Problematik interkultureller Kommunikation ist ein Forschungsfeld der Migrations- und Diasporaforschung, somit kann die Thematik der Missionskinder auch mit heutigen Phänomenen verglichen werden. Im Seminar soll der Fokus allerdings eher auf dem historischen Material liegen. Anhand verschiedener Quellen, zum Beispiel archivalischen Selbstzeugnissen wie Briefen, Tagebucheinträgen, Reiseberichten, aber auch anhand offizieller Verwaltungsdokumente sowie zeitgenössischer Sekundärliteratur soll folgenden Fragen nachgegangen werden: Wie wurde die 'Kinderverschickung' begründet? Von Seiten der Mission, der Eltern etc.? Welche Folgen zeitigte dieses Verfahren? Für die Eltern? Wie gingen sie mit dem Verlust um? Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Was bedeutete das für die Kinder unter dem Aspekt des Überganges, der Transition: dem Verlorengehen und dem Verlorensein? Wie gingen sie mit dem Wechsel von der alten exotischen Heimat in die europäische Fremde? Wie bewältigten sie den Verlust auch der sprachlichen Heimat? Deutsch war für die meistens Fremdsprache. Wie ging man mit diesen Schwierigkeiten im Kinderhaus um? Wie reagierte die Basler Bevölkerung auf die Missionskinder? Welche Rolle spielte Religion? Kann sie beispielsweise eine Ersatzheimat bieten? Welche Rolle spielt sie bei der weiteren Identitätsfindung? Wir versuchen uns dem Phänomen der Missionskinder aus unterschiedlichen Perspektiven anzunähern. Eingeübt werden soll das Arbeiten mit und das Auswerten und Interpretieren von historischen Quellen. Dafür wird auch eine Einheit Einführung in das Lesen der Deutschen Schrift angeboten und der Besuch des Archivs der Basler Mission, eventuell kleinere praktische Übungen im Archiv. |
| Literatur | - Jenkins, Paul: Was ist eine Missionsgesellschaft?. In: Wilfried Wagner (Hg.): Kolonien und Missionen 3. Internationales kolonialgeschichtliches Symposium 93. Münster, Hamburg 1994, S. 441-451. - Konrad, Dagmar: Missionsbräute Pietistinnen des 19. Jahrhunderts in der Basler Mission. Münster u. a. 2001, S. 1-13 und S. 406-452. - Scharfe, Martin: Lebensläufe. Intentionalität als Realität. Einige Anmerkungen zu pietistischen Biographien. In: Rolf Wilhelm Brednich u. a. (Hg.): Lebenslauf und Lebenszusammenhang. Autobiographische Materialien in der volkskundlichen Forschung. Vorträge der Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde in Freiburg i. Br. vom 16. März bis 18. März 1981. Freiburg i. Br. 1982, S. 113-126. |
| Teilnahmevoraussetzungen | Die Teilnehmerzahl ist auf 35 beschränkt; Studierende der Kulturanthropologie werden vorgezogen. Falls noch freie Plätze vorhanden sind, so werden diese nach Anmeldedatum vergeben. |
| Anmeldung zur Lehrveranstaltung | via homepage Seminar für Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie vom 20.1.09 bis zum 3.2.09 |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Modul Christentum (Bachelor Studienfach: Religionswissenschaft) Modul Migration et identités (Master Studiengang: Etudes françaises et francophones) Modul Schrift (Theorien, Methoden und Perspektiven der Analyse schriftlicher Kultur) (Bachelor Studienfach: Kulturanthropologie) Modul Schrift 2 (Theorien, Methoden und Perspektiven der Analyse schriftlicher Kultur) (Master Studienfach: Kulturanthropologie) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | Pass / Fail |
| Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Seminar für Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie |