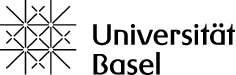Zurück zur Auswahl
22034-01 - Seminar: Ergießungen: Texte und Tränen (Forschungsseminar) (3 KP)
| Semester | Herbstsemester 2009 |
| Angebotsmuster | einmalig |
| Dozierende | Elsbeth Dangel Pelloquin (elsbeth.dangel-pelloquin@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Tränen scheinen eine anthropologische Konstante zu sein. Nicht konstant sind indessen die kulturhistorischen Semantiken der Tränen, die geschlechtsspezifischen Differenzen des Weinens und die Gefühle, denen die Tränen geschuldet sind. Im Weinen wird die Körperoberfläche zum Schauplatz innerer Regungen. Tränen überwältigen das Subjekt und scheinen dadurch eine authentische Unmittelbarkeit des Ausdrucks jenseits der Sprache zu verbürgen. Aber diese Entäußerung des Innern bleibt semantisch uneindeutig und umspannt die gesamte Gefühlsskala von Freude bis zu Zorn und Trauer. Zudem können Tränen auch manipulierend eingesetzt und zum Instrument der Verstellung werden. Tränen ergießen sich in Texte und auf das Papier. Sie manifestieren sich als Material, etwa als verräterische Spuren in Briefen. Sie können das Movens sein, das die Texte hervortreibt, und sie können wiederum im Rezipienten des Textes aufsteigen. Die sprachliche Evokation der Tränen in Texten wirft die Frage nach ihrer (buchstäblichen und metaphorischen) Darstellbarkeit auf. Nach einführenden Überlegungen zur Physiologie und zur Kulturgeschichte der Tränen wollen wir Tränen in literarischen Texten aufspüren, wobei uns die Forschungsliteratur eine begleitende Reflexion ermöglichen soll. An einem kulturhistorischen Leitfaden entlang werden besonders tränenfeuchte Texte darauf befragt, was Funktion, Bedeutung und Potenzial der Tränen sein könnte, welche Auskünfte sie zum semiotischen, semantischen, anthropologischen Konzept der Texte geben, welche Geschlechterdifferenzen sie herstellen und wie sie sprachlich verfasst sind. Schließlich soll uns interessieren, ob den Texten eine Poetik der Tränen abzulesen ist. An einen Ausblick auf Tränendarstellungen in der bildenden Kunst und auf musikalische Ausdrucksformen von Tränen ist gedacht. MusikwissenschaftlerInnen und KunstwissenschaftlerInnen sind deshalb besonders willkommen. Roland Barthes hat einmal eine Geschichte der Tränen verlangt. Die können wir nicht schreiben, aber vielleicht können wir doch Fragmente einer (literarischen) Tränensprache zusammenstellen, die diesem in der Literaturwissenschaft bisher wenig beachteten Ausdrucksphänomen neue Aufmerksamkeit schenken. |
| Lernziele | siehe Inhalt |
| Literatur | Gisela Berkenbusch: Zum Heulen: Kulturgeschichte unserer Tränen. Berlin: Transit 1985. Tom Lutz: Crying: the natural and cultural history of tears. New York: W.W. Norton & Company 1999. (Dt: Tränen vergießen. Über die Kunst zu weinen. Hamburg: Europa Verlag 2000). Beate Söntgen und Geraldine Spiekermann (Hrsg.): Tränen. Paderborn: Fink 2008. Die Liste der zu behandelnden literarischen Texte wird am Semesterbeginn bekannt gegeben. |
| Teilnahmevoraussetzungen | siehe Studienordnung |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Modul Allgemeine Literaturwissenschaft (Master Studienfach: Deutsche Literaturwissenschaft) Modul Allgemeine Literaturwissenschaft (Master Studienfach: Neuere Deutsche Literaturwissenschaft) Modul Forschungsorientiertes Studium (Master Studienfach: Neuere Deutsche Literaturwissenschaft) Modul Forschungsorientiertes Studium (Master Studienfach: Deutsche Literaturwissenschaft) Modul Neuere Deutsche Literaturwissenschaft I (Master Studienfach: Deutsche Philologie) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Regelmäßige Teilnahme, Kurzreferate mit anschließender schriftlicher Ausarbeitung, diverse Arbeitsaufträge. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmelden: Belegen; Abmelden: nicht erforderlich |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | Pass / Fail |
| Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Historische Fakultät, studadmin-philhist@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Deutsches Seminar |