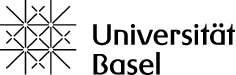Zurück zur Auswahl
23814-01 - Seminar: Probleme der Medizinethik (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2010 |
| Angebotsmuster | einmalig |
| Dozierende | Dagmar Fenner (dagmar.fenner@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Infolge des enormen Kenntniszuwachses und des technischen Fortschritts in der modernen Medizin ergaben sich viele neue moralische Konflikte und Probleme. So stellen sich die Fragen nach der ethischen Legitimität der Organentnahme bei hirntoten Menschen erst seit der Möglichkeit von Organtransplantationen, diejenigen im Bereich der Reproduktionsmedizin erst seit den Möglichkeiten künstlicher Befruchtung oder des Klonierens. Die meisten Konflikte entstehen dadurch, dass das technisch Machbare sich nicht mehr mit dem deckt, was sich die Betroffenen oder die Gesellschaft von der Medizin erhoffen. Vielen Menschen macht es beispielsweise Angst, dass ihr Leben künstlich verlängert werden kann, auch wenn sie längst das Bewusstsein verloren haben. Man sieht dabei etablierte Moralvorstellungen unterwandert, etwa das Recht jedes Menschen auf ein menschenwürdiges Dasein. Durch die neu eröffneten Interventionsmöglichkeiten der Ärzte hat sich zugleich das Arzt-Patient-Verhältnis kompliziert. Denn dadurch nimmt zwangsläufig die Abhängigkeit der Patienten von der Ärzteschaft zu. Im Laufe mehrerer Individualisierungsschübe der westlichen Industriestaaten haben allerdings die Ärzte und medizinischen Forscher erheblich an Autorität eingebüsst. So wird heute jede Art von ärztlicher Bevormundung beargwöhnt und stattdessen Patientenautonomie und ein partnerschaftliches Arzt-Patient-Verhältnis gefordert. Gerade bei klassischen Problemen der Abtreibung oder Sterbehilfe sind Betroffene, Angehörige und die Öffentlichkeit nicht länger bereit, die ethische Normierung einfach der ärztlichen Zunft zu überlassen. Nicht zuletzt nimmt angesichts des technisch Machbaren das Problem der Güterknappheit im Gesundheitswesen bisher unerreichte Dimensionen an. Denn die neuen technisch möglichen Leistungen werden immer kostspieliger und somit ökonomisch unmöglicher, bei gleichzeitig gesteigerten Ansprüchen der Patienten. Von allen Bereichsethiken der Angewandten Ethik hat sich die Medizinethik am weitestgehendsten etabliert. Ziel des Seminars ist es, in die zentralen medizinethischen Probleme, die relevanten Prinzipien, Konzepte und Begründungsmethoden einzuführen und konkrete Beispiele aus der Praxis zu diskutieren. Neben der Lektüre der unten angegebenen Aufsatzsammlung vor Beginn des Blockseminars wird von den TeilnehmerInnen die Übernahme eines Kurzreferats erwartet. Bitte melden Sie sich bis zum 15. 1. 2010 bei: dagmarfenner@hotmail.com. |
| Lernziele | Überblick über die wichtigsten Fragestellungen und theoretischen Konzeptualisierungen in der Medizinethik |
| Literatur | Lektüre: Schulz, Stefan, Steigleder, Klaus, Fangerau, Heiner und Paul, Norbert W. (Hrsg.): Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Frankfurt a. M. 2006. |
| Bemerkungen | Bitte melden Sie sich bis zum 15. 1. 2010 bei: dagmarfenner@hotmail.com - Für Juristen geeignet. |
| Weblink | http://www.unibas.ch/AngewandteEthik/ |
| Teilnahmevoraussetzungen | Erfolgreicher Besuch von VL A |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Basismodul (Teil B) (Transfakultäre Querschnittsprogramme im freien Kreditpunkte-Bereich) Modul Praktische Philosophie (Master Studienfach: Philosophie) Modul Probleme der Praktischen Philosophie (Bachelor Studienfach: Philosophie) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | mündliches Referat |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | An- und Abmelden: Dozierende |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | Pass / Fail |
| Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Universität Basel |
| Anbietende Organisationseinheit | Forschungsstelle für angewandte Ethik |