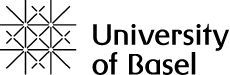Back to selection
76576-01 - Practical course: ICH, WIR und die ANDEREN. Musikalisches Handeln und die Konstruktion von Identität (3 CP)
| Semester | fall semester 2025 |
| Course frequency | Once only |
| Lecturers | Matthias Hornschuh (matthias.hornschuh@unibas.ch, Assessor) |
| Content | Es gilt als unhöflich, sich selbst so wie im Titel einer Aufzählung voranzustellen, was einiges darüber auszusagen vermag, welche Bedeutung dem Funktionieren von Gruppen und sozialen Gefügen zugemessen wurde, als diese ungeschriebene Regel entstand. Nun gibt schlicht kein WIR ohne ein ICH, und daher natürlich auch keine ANDEREN. Anders gesagt: Erst durch die kategorielle Unterscheidung ICH - WIR bzw. ICH/WIR - die ANDEREN konstituiert sich unsere Identität. Die eigene wie auch die diversen kollektiven Identitäten, oder vielleicht eher die vielen Facetten von Identität, die von verschiedenen Kollektiven, Gruppen, Kulturen, Gesellschaften geprägt sind. Sie machen uns aus, sie gilt es zu balancieren und gelegentlich durchaus auch zu inszenieren — etwa durch Musik. Soweit einige musikpsychologische Grundannahmen, die zunächst einmal Verhaltensweisen in eigenen, also tendenziell westlichen kulturellen Kontexten adressieren. Musik gibt es aber auf der ganzen Welt, und auch im Westen gibt es nichtwestliche Musik von Menschen, die sich womöglich gelegentlich fragen, ob und inwieweit sie eigentlich anerkannter Teil des WIRs sind, von dem ständig die Rede ist. Das Verhältnis von Musik und Identität lässt sich also offenbar auch ganz anders kontextualisieren; mit den Mitteln und aus der kulturübergreifenden Perspektive der Ethnomusikologie etwa. Eine aktuelle ethnomusikologische Grundannahme über die Rolle der Musik im Leben der Menschen sieht eine zentrale Funktion von Musik darin, „zur Identitätsstiftung von Individuen, Gruppen und Gesellschaften maßgeblich beizutragen.“ (Grupe 2011, S. 8) Dabei wird oft keine homogene und ganz sicher keine statische Eineindeutigkeit entstehen; vielmehr gibt es in einer zusehends globalisierten und digitalisierten Welt immer öfter prozesshafte Patchwork-Identitäten (Keupp et al.) oder auch Bastelexistenzen (Hitzler&Honer), die als „kulturelle Identität“ (Hall) beschrieben werden können. Die Übung „ICH, WIR und die ANDEREN“ richtet den Blick auf die Definition von Zugehörigkeit und Abgrenzung und auf die aktive, suchende und gestaltende Konstruktion von Identitäten und damit auch auf die gesellschaftliche Funktion identitätsstiftenden musikalischen Verhaltens, etwa für die Gestaltung von Ritualen, für Macht und Kapital und für politische Auseinandersetzungen. Zugleich gilt die Aufmerksamkeit der Frage, wie ich, wir und die Anderen in unserem Denken und Fühlen konstruiert werden und repräsentiert sind, wie wir Menschen also uns denken und wahrnehmen: selbst, als Gemeinschaft und in Unterscheidung von anderen. Ausgehend von einem orientierenden Blick in die Theorie soll sie es den Teilnehmenden, ermöglichen, das Spiel der Identitäten, dessen Regeln sich angesichts des „Verdampfens“ von Gesellschaftlichkeit (Beck & Beck-Gernsheim) immer schneller weiterentwickeln, zu lesen, wie man im Fußball sagt. Apropos: Haben Sie schon mal über die Bedeutung von Fußballfangesängen nachgedacht? Darüber, wie es sein kann, dass einzelne Menschen oder Gruppen von Menschen für sich reklamieren, das Eigentum an einer Musik zu besitzen - an einer Musik, die andere ja ohne weiteres auch hören, singen und tanzen können? Oder über die Gründe, die die Band Kraftklub gehabt haben könnte, einen bitterbösen Song über ihre Fans zu schreiben? Lassen Sie uns gemeinsam darüber nachdenken! |
| Bibliography | * Adorno, T. W. (1962): Einleitung in die Musikpsychologie. Zwölf theoretische Vorlesungen. 7. Auflage 1989. Frankfurt am Main: Suhrkamp. * Appen, R. von (2011): Authentizität des Ausdrucks - Intensität des Eindrucks. Zur Bedeutung des Emotionalen in der populären Musik. In: Auhagen, W., Bullerjahn, C. & Höger, H. (HG, 2011): Musikpsychologie. Jahrbuch der deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie. Band 21: Musikselektion zur Identitätsstiftung und Emotionsmodulation. Göttingen: Hogrefe. S. 56-89 * Beck, U. & Beck-Gernsheim, E. (1994): Individualisierung in modernen Gesellschaften - Perspektiven und Kontroversen einer subjektorientierten Soziologie. In: Beck, U. & Beck-Gernsheim, E. (HG): Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 10-39. * Bourdieu, P. (1982): Die feinen Unterschiede. Kritik an der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp. * Georgi, R. von, Kraus, H., Cimbal, K. & Schütz, M. (2011): Persönlichkeit und Emotionsmodulation mittels Musik bei Heavy Metal-Fans. In: Auhagen, W., Bullerjahn, C. & Höger, H. (HG, 2011): Musikpsychologie. Jahrbuch der deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie. Band 21: Musikselektion zur Identitätsstiftung und Emotionsmodulation. Göttingen: Hogrefe. S. 90-118. * Grupe, G. (2011): Ziehen der Zugehörigkeit und Mittel der Abgrenzung. Prozesse der Identitätsstiftung aus ethnomusikologischer Sicht. In: Auhagen, W., Bullerjahn, C. & Höger, H. (HG, 2011): Musikpsychologie. Jahrbuch der deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie. Band 21: Musikselektion zur Identitätsstiftung und Emotionsmodulation. Göttingen: Hogrefe. S. 7-29. * Hall, S. (1994): Die Frage der kulturellen Identität. In: Hall, S. (1994, HG): Rassismus und kulturelle Identität. Ausgewählte Schriften 2. Hamburg: Argument. S. 180-222. * Hargreaves, D. (1982): The development of aesthetic reaction to music. In: Psychology of Music, Social Issue, 10, 51-54. * Hargreaves, D., Miell, D. & MacDonald, R. (2004): What are musical identities, and why are they important? In: Hargreaves, D., Miell, D. & MacDonald, R. (2004, HG): Musical Identities. Oxford: Oxford University Press. S. 1-20. * Hitzler, R. & Hohner, A. (1994): Bastelexistenz. Über subjektive Konsequenzen der Individualisierung. In: Beck, U. & Beck-Gernsheim, E. (HG): Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften. S. 307-315. Frankfurt am Main: Suhrkamp. * Keupp, H., Abbe, T. Gmür, W., Höfer, R., Mitzscherlich, B., Kraus, W. & Staus, F. (2002): Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne. Reinbek: Rowohlt. * Merriam, A. P. (1964): The Anthropology of Music. Evanston/Illinois: Northwestern University Press. * Müller, R. (2000): Die feinen Unterschiede zwischen verbalen und klingenden Musikpräferenzen Jugendlicher. Eine computerunterstützte Befragung mit dem Fragebogen-Autorensystem MultiMedia. In: Klaus-Ernst Behne, Günther Kleinen, Helga de la Motte-HaberMusikpsychologie (HG): Musikpsychologie. Jahrbuch der deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie. Band 15: Die Musikpersönlichkeit. Hogrefe. 87 - 98. * Renate, R., Glogner, P., Rhein, S. & Heim, J. (HG, 2002): Wozu Jugendliche Musik und Medien gebrauchen. Jugendliche Identität und und musikalische und mediale Geschmacksbildung. Weinheim, München: Juventa. * Müller, R. (2007): Zur Rolle der Musik in neueren Identitätskonzepten. In: Spahn, C. (2007, HG): Musik und Identität. Tagungsband zur Internationalen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen vom 14.-16.September 2007. Freiburg: Burger. S. 79-80. * Rösing, H. (1995): Musikalische Sozialisation. In: Helms, Siegmund, Schneider, Reinhard & Weber, Rudolf (HG): Kompendium der Musikpädagogik (S. 349-372). Kassel/Regensburg: Bosse. * Weindl, S. (2005): Musik & Aggression. Untersucht anhand des Musikgenres Heavy Metal. Frankfurt: Peter Lang. |
| Language of instruction | German |
| Use of digital media | No specific media used |
| Course auditors welcome |
| Interval | Weekday | Time | Room |
|---|---|---|---|
| Block | See individual dates | ||
Dates
| Date | Time | Room |
|---|---|---|
| Monday 15.09.2025 | 10.00-18.00 | Musikwissenschaft, Vortragssaal |
| Tuesday 16.09.2025 | 10.00-14.00 | Musikwissenschaft, Vortragssaal |
| Monday 06.10.2025 | 10.00-13.45 | Kollegienhaus, Sitzungszimmer 206 |
| Monday 27.10.2025 | 10.00-14.00 | Musikwissenschaft, Vortragssaal |
| Monday 01.12.2025 | 10.00-18.00 | Musikwissenschaft, Seminarraum 101 |
| Tuesday 02.12.2025 | 10.00-14.00 | Musikwissenschaft, Vortragssaal |
| Modules |
Electives Bachelor Musicology: Recommendations (Bachelor's degree subject: Musicology) Modul: Kulturtechnische Dimensionen (Master's degree program: Cultural Techniques) Modul: Musikwissenschaftliche Praxis (Bachelor's degree subject: Musicology) |
| Assessment format | continuous assessment |
| Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration; dereg.: not required |
| Repeat examination | no repeat examination |
| Scale | Pass / Fail |
| Repeated registration | no repetition |
| Responsible faculty | Faculty of Humanities and Social Sciences, studadmin-philhist@unibas.ch |
| Offered by | Fachbereich Musikwissenschaft |